- Behandlung
Hinter die Dinge schauen: Kinder-Diabetologin und Coach Dr. Katja Schaaf im Interview
13 Minuten

Dr. Katja Schaaf brennt für ihre Aufgaben – und ist an ihnen gewachsen. Als Kinder-Diabetologin und Coach will sie Kindern und Jugendlichen nicht nur beibringen, wie Glukosewerte und Insulin zusammenhängen. Ihr ist wichtig, durch bislang Unbewusstes den ein oder anderen „Knoten“ zu lösen.
Im Interview: Dr. med. Katja Schaaf
Einfach nur als Kinder- und Jugendärztin und Diabetologin zu arbeiten, reichte Dr. Katja Schaaf nicht. Sie erkannte bei ihrer Arbeit, dass es mehr gibt als Glukosewerte und -verläufe, die man durch Insulin und Essen steuert. Da gab es noch das Unausgesprochene, das Unbewusste. „Wenn in der Diabetologie etwas ruckelig wurde bei den Glukoseverläufen, hat man auf Ernährung geguckt, auf Sport, die Hormone – und es war doch noch irgendwas, das nicht funktioniert hat. Da habe ich schnell gemerkt: Wenn man nicht weiterkam, wurden Kinder und Jugendliche noch zum Psychotherapeuten geschickt.“

Den ganzen Eisberg betrachten
Katja Schaaf erweiterte ihren Horizont und ihr Wissen in dieser Richtung, zum einen in die Psychosomatik. Zum anderen ließ sie sich in contextuellem Coaching fortbilden. Heute blickt sie mit ihren Diabetes-Familien, speziell den Kindern und Jugendlichen, in der Sprechstunde unter die Wasseroberfläche und betrachtet den ganzen Eisberg, nicht nur dessen Spitze, die hinausragt. „Beim contextuellen Coaching guckst du, was drunterliegt, also eher, was unbewusste Gedankenmuster sind, die dein Handeln beeinflussen. Denn 95 Prozent unserer Handlungen sind unbewusst und nur über 5 Prozent sind wir uns im Klaren.“
Eigene Grenzen reflektieren, um Menschen zu helfen
Eigentlich gehört dieses Herangehen auch zur klassischen Medizin, findet Katja Schaaf, und ergänzt: „Was dazugehört, ist auch Selbstreflexion, also bei sich selbst zu schauen. Wenn ich selbst Grenzen habe, kann ich das auch bei Patienten nicht erkennen, weil es eben auch mein blinder Fleck ist.“ Sie selbst hat durch ihren Weg auch viel gewonnen – und ist ein rundum zufriedener Mensch.
Diabetes-Anker (DA): Katja, Du bist Kinder- und Jugendärztin in einer Klinik, Diabetologin und Endokrinologin und außerdem weitergebildet in der Ernährungsmedizin und Psychosomatik. Wie war dein Weg zu dieser Vielseitigkeit?
Dr. Katja Schaaf: Das ist eine schöne Frage, weil ich mich eine Zeitlang gefühlt habe, als hätte ich einen Bauchladen, den ich vor mir rumtrage. Tatsächlich ist es so, dass der Kreis sich jetzt schließt. In der ersten Klinik, in der ich als Ärztin im Praktikum angefangen habe zu arbeiten, also noch vollkommen unerfahren war, war es in den Diensten so, dass es für die Kinder mit Diabetes einen Zettel gab, auf den ein Arzt mit Erfahrung schaute: „Der Blutzucker ist so – so viel Insulin abgeben.“
Ich habe das nicht verstanden. Ich hatte gelernt, dass Diabetes auch etwas mit Ernährung zu tun hat. Und wenn die Kinder anders essen und wenn sie erhöhte Ketone haben, kann das doch nicht nur dieser Plan sein. Ich durfte in der Klinik aber nichts machen, weil ich halt unerfahren war. So ist das Interesse entstanden. Ich finde das spannend, denn wenn du Diabetes verstehst, ist er ja relativ einfach zu behandeln.
In der zweiten Klinik, in der ich mich beworben habe, habe ich extra darauf geachtet, dass eine Diabetologie dabei war. Dort habe ich die Weiterbildung Diabetologie abgeschlossen und hatte das Glück, einen ganz tollen Oberarzt zu haben, der mich schon früh viel hat machen lassen. Dadurch habe ich wahnsinnig viel gelernt, wir haben Schulungen gemacht und zusammen mit der Diabetesberaterin dort Schulungsmaterialien selbst erstellt.
„Wenn man nicht weiterkam, wurden Kinder und Jugendliche noch zum Psychotherapeuten geschickt. Und dann habe ich geschaut, dass ich selbst noch was dazu nehme in Bezug auf die Psyche.“
Dann hatte ich meinen Facharzt und die Frage war, wie es weitergeht. Zufällig berichtete eine Pharmavertreterin, dass die Uniklinik jemanden für die endokrinologische Weiterbildung sucht , der ein bisschen Erfahrung in der Diabetologie hat. Das fand ich super, denn wenn man Hormone versteht, versteht man auch den Zuckerverlauf manchmal besser. So habe ich die Endokrinologie dazu genommen.
Und Ernährungsmedizin habe ich gemacht, weil ich zwischen diesen beiden Stellen zwei Monate Auszeit hatte. Ich hätte entweder reisen können oder gucken, was ich noch dazu nehme, was mir später auch die Arbeit vereinfacht und wo ich noch mehr Verständnis entwickle. Da passt die Ernährung super rein. Es gab gerade einen Kurs quasi vor der Haustür… Dann hatte ich dieses Dreierpaket.
Aber ich habe gemerkt, dass immer noch irgendwas fehlt als Baustein. Wenn in der Diabetologie etwas ruckelig wurde bei den Glukoseverläufen, hat man auf Ernährung geguckt, auf Sport, die Hormone – und es war doch noch irgendwas, das nicht funktioniert hat. Da habe ich schnell gemerkt: Wenn man nicht weiterkam, wurden Kinder und Jugendliche noch zum Psychotherapeuten geschickt. Und dann habe ich geschaut, dass ich selbst noch was dazu nehme in Bezug auf die „Psyche“. Die psychosomatische Grundversorgung war das, was man als Zusatzbezeichnung noch machen kann. Das fand ich total wertvoll als Ergänzung.
DA: Welche Aufgaben hast du jetzt in der Klinik?
Dr. Schaaf: Ich habe meine Arbeitszeit im Elisabeth-Krankenhaus in Essen reduziert, weil ich parallel noch eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. In der Klinik habe ich eine Oberarztstelle und habe dort eine große Ambulanz für Kinder und Jugendliche mit Diabetes und Endokrinologie aufgebaut. Nach seiner Ausbildung wurde diese Ambulanz jetzt von einem Kollegen übernommen.
Ich betreue in der Klinik zum einen ambulant Kinder und Jugendliche mit diabetologisch-endokrinologischen Krankheitsbildern, von Diagnosestellung über Therapieumstellung, Neueinstellung, zum anderen stationär Kinder, die mit einer Diabetes-Manifestation kommen oder zur Schulung. Hinzu kommt die so wichtige Ausbildung von jungen Kollegen, die in der Weiterbildung nachrücken.
DA: Du hast eben das Coaching erwähnt, das du parallel machst. Du bist auch ausgebildet in contextuellem Coaching und Business-Coaching. Was war der Auslöser dafür?
Dr. Schaaf: Ich habe ja die psychosomatische Grundversorgung gemacht und auch da habe ich gemerkt: Das war halt noch sehr medizinisch-kognitiv geprägt. Weil die Jugendlichen oft gekommen sind und gesagt haben, „Immer, wenn wir zu dir kommen, sind danach ein paar Themen aufgelöst“, habe ich gedacht, dass ich aber nicht ausgebildet bin dafür. Ich habe lange gesucht, was ich machen könnte, und Coaching-Ausbildungen sind sehr unterschiedlich.
Ich war dann sehr dankbar, dass ich diese Ausbildung gefunden habe. Heute gibt es die in der Form nicht mehr. Die Ausbildung hatte auch viele psychotherapeutische Aspekte und das war das, was mir damals sehr geholfen hat, weil ich tatsächlich die letzten Feinschliffe gekriegt habe, um Patienten noch einmal anders in Verantwortung zu bringen, ohne dass es wie ein nasser Waschlappen ins Gesicht ist, sondern wirklich zu schauen, wo es vielleicht noch hängt: „Was denkst du noch über die Erkrankung, über dich?“ Oft ist das unbewusst und man kann es gar nicht selbst benennen.
DA: Was ist der Unterschied zwischen Coaching und contextuellem Coaching?
Dr. Schaaf: Der Hauptunterschied liegt meiner Meinung nach darin, dass du beim contextuellen Coaching schaust, was darunterliegt, also eher, was unbewusste Gedankenmuster sind, die dein Handeln beeinflussen. Denn 95 Prozent unserer Handlungen sind unbewusst und nur über 5 Prozent sind wir uns im Klaren. Beim contextuellen Coaching schaust du unter der Wasseroberfläche, was im Eisberg wirkt. Die Titanic wäre nicht gesunken, wenn die Spitze des Eisbergs das Problem gewesen wäre, sondern die ist ja auch unten dagegen geprallt.
Und das ist auch meine Erfahrung: Wenn gerade in der Diabetologie Dinge nicht umgesetzt werden, dann ist das nicht, weil jemand nicht will, und meistens auch nicht, weil er nicht kann oder es nicht weiß. Es gibt immer eine Lücke zwischen Wissen und Tun und das habe ich dort in der Ausbildung gelernt: andere Fragen zu stellen, dass man auf das guckt, was nicht so offensichtlich ist.
DA: Warum kann die klassische Medizin das deiner Meinung nach nicht abbilden?
Dr. Schaaf: Ich glaube, sie könnte das, wenn wir zum einen als klassische Mediziner das mit in der Ausbildung hätten. Was dazugehört, ist auch Selbstreflexion, also bei sich selbst zu schauen. Wenn ich selbst Grenzen habe, kann ich das auch bei Patienten nicht erkennen, weil es eben auch mein blinder Fleck ist. In der klassischen Medizin sind wir sehr fokussiert auf die Werte. Die Glukosewerte, Verläufe und Befunde werden besprochen, aber wir haben gar nicht gelernt zu untersuchen, was vielleicht hinter den Werten liegt. Das kostet am Anfang vielleicht einmal mehr Zeit, spart aber danach Zeit.
DA: Wer profitiert besonders von contextuellem Coaching?
Dr. Schaaf: Eigentlich profitiert davon jeder, weil wir alle unsere blinden Flecken haben. Ich glaube, jeder, der wirklich etwas verändern will und bereit ist, auch mal dahin zu gucken, wo es erstmal unangenehm ist, der profitiert davon. Wenn wir an die Denkmuster gehen und sie verändern wollen, profitieren wir unglaublich.
DA: Du kommst aus der Kinder- und Jugendmedizin. Das contextuelle Coaching ist, wie ich dich jetzt verstanden habe, eigentlich für jeden geeignet. Siehst du Unterschiede zwischen den Kindern und Jugendlichen und den Erwachsenen, wenn du sie betreust?
Dr. Schaaf: Ja, die Kinder und die Jugendlichen sind schneller, das ist total schön zu sehen. Im Grunde ist es tatsächlich so: Je älter wir werden, desto festgefahrener sind wir in unseren Gewohnheiten, in unseren Mustern und in unseren Sichtweisen über uns und übers Leben. Und die Jugendlichen und je jünger die Kinder sind, die haben das halt noch nicht so. Wenn du dir kleine Kinder anguckst, die probieren aus, die machen Fehler. Aber die sehen das nicht als Fehler, sondern sagen: „Ah, hat nicht geklappt, probiere ich wieder.“ Die sind risikobereiter, bereiter, auch was Neues auszuprobieren und sich auf unbekannte Sachen einzulassen – das verlieren die Erwachsenen ja relativ schnell.
DA: Kommen die Menschen mit konkreten Aspekten oder Fragen zu dir oder ist es eher so, dass du in der Ambulanz zum Beispiel merkst, da wäre Bedarf, und dann die Kinder und die Eltern ansprichst?
Dr. Schaaf: Es ist beides. Die Mehrheit ist aber so, dass ich durch diese Ausbildung schneller eine Diskrepanz sehe zwischen dem, was jemand sagt, und den Werten. Dann spreche ich die Kinder und Jugendlichen schneller an. Ich habe zum Beispiel eine Jugendliche mit AID-System, bei der ich in den CGM-Daten immer gesehen habe, dass die Werte ganz stabil waren und auch im angestrebten Bereich.
Und dann gab es Zacken nach oben und dann wieder Abfälle. Bei den Zacken nach oben waren manchmal Insulinabgaben verzeichnet und manchmal nicht. Und wenn Insulin abgegeben war, war das nach dem Glukoseanstieg. Was ich mir abgewöhnt habe, ist, zu sagen, was ich denke, sondern ich frage nach: „Wann gibst du dein Insulin ab?“ „Vor dem Essen.“ „Kann das sein, dass du es manchmal auch anders machst?“ „Ach ja, dann und dann…“ Als ich dann über die Werte geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass bei Hunderter-Werten immer diese Anstiege waren und zum Teil kein Insulin abgegeben wurde.
Dann habe ich gefragt: „Gibt es irgendwas, wovor du Angst hast oder was du befürchtest?“ Sie sagte: „Ja, Unterzuckerungen.“ Und dann habe ich gedacht: Okay, das passt zu dem, was ich aus diesen Daten sehe. Dann habe ich weitergefragt: „Hast du das mal erlebt, eine Unterzuckerung?“ „Ja.“ „Wie tief warst du da?“ „52.“ „Hast du da was gespürt?“ „Nee, da ging’s mir gut.“ Dann habe ich gedacht: Dann kann es die Erfahrung nicht sein, dass man automatisch anfängt zu essen, weil man Angst hat vor einer Unterzuckerung. Daraufhin habe ich weitergefragt: „Was ist das Schlimmste, was passieren könnte in einer Unterzuckerung?“ Und dann schossen ihr die Tränen in die Augen, sie hat mich angeguckt und gesagt: „Das möchte ich nicht sagen.“ In dem Moment habe ich nur gesagt: „Weißt du was? Ich glaube, ich weiß was du denkst.“
„Das sind Momente, wo ich mich so freue, dass ich diese Ausbildung genießen durfte, weil das, glaube ich, einen Unterschied in der Beratung macht.“
„Ich weiß, was du sagen möchtest und möchte nur, dass du es einmal aussprichst, damit es einmal auf dem Tisch und raus ist.“ Und sie: „Ich möchte das nicht sagen.“ „Du, es passiert nichts. Einfach mal aussprechen.“ Dann hat sie wirklich gesagt: „Ja, dass ich dann sterbe.“ Wenn du das nicht erkennst – und das wäre mir ohne die Ausbildung, glaube ich, nicht gelungen –, dann hätte ich geschult, Insulin vorm Essen abzugeben, kein Essen ohne Insulinabgabe, in der Hypo nicht zu viel zu essen. Ich hätte das klassische Standardprogramm gefahren.
Ich habe sie angeguckt und gefragt: „Wie kommst du darauf? Hast du jemanden erlebt?“ Dann habe ich weitergefragt und es war wirklich so, dass ich erst mal diese Geschichte kaputtgemacht und gesagt habe: „Okay, dass es nicht passiert, dass man in der Unterzuckerung stirbt, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber es passiert nur, wenn…“ Dann habe ich die Szenarien aufgelistet, die zwar unwahrscheinlich sind, aber die man so kennt: Jemand hat Alkohol getrunken, läuft am Fluss vorbei, fällt rein, wird gefunden, niedriger Blutzucker gemessen. Oder du hast wirklich das Insulin vollkommen verwechselt, hast keine Körperwahrnehmung, hast keinem Bescheid gesagt – dass sie merkt: Okay, das Szenario ist relativ unwahrscheinlich.
Sie hat mich angeguckt und gesagt: „Ich habe gerade keine Angst mehr.“ Du konntest das im Gesichtsausdruck sehen, wann dieser Switch da war. Ich habe ihr noch erzählt, welche Gegenregulation es gibt, welche Symptome und dass man selbst steuern kann, ob man sie ignoriert – was gefährlich wäre – oder nicht. Das sind Momente, wo ich mich so freue, dass ich diese Ausbildung genießen durfte, weil das, glaube ich, einen Unterschied in der Beratung macht. Heraus kam auch noch, dass die Angst durch Video auf Social Media entstanden ist, da dort jemand mit Diabetes durch Insulin und Unterzuckerung umgebracht wurde…
DA: Melden sich auch Menschen außerhalb der Ambulanz bei Dir?
Dr. Schaaf: Ja, es gibt Menschen, die mich schon mal anschreiben, einen Diabetes haben, die ein spezielles Thema haben oder denen es nicht so gut geht, die vielleicht die Diagnose noch nicht angenommen haben. Ich sage dann immer: „Ihr dürft euch darum kümmern, annehmen muss man es nicht. Hauptsache, man versorgt es.“ Damit nimmt man schon mal den Druck weg, dass ich das annehmen müsste.
Man muss nicht sagen, Diabetes ist toll oder er macht nichts in meinem Alltag – das stimmt ja nicht. Aber zu sagen, ich versorge ihn trotzdem… Das sind so die Anfragen, die ich extern kriege, also nicht von meinen Patienten. Da geht es eher um Akzeptanz, Zustimmung, vielleicht auch Abgrenzung, wenn Verwandte sehr „übergriffig“ sind, also immer vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe.
Noch ein Beispiel: wenn Werte nicht zu dem passen, was jemand sagt, zum Beispiel „Ich mache immer alles, was ihr mir gesagt habt, ich setze das um“ und du siehst, es passt nicht, dann nicht hinzugehen und zu sagen „Der lügt, der macht das eh nicht“, sondern zu gucken, was der Fall sein könnte. Haben wir uns vielleicht kommunikativ irgendwo missverstanden, gab es da irgendeine Lücke? Das ist im Grunde eine niederschwellige Psychotherapie.
DA: Wenn Menschen direkt in deine Coaching-Angebote kommen, wie läuft ein Coaching dann ab?
Dr. Schaaf: Ich mache das sowohl live als auch per Zoom. Ich frage erst mal ganz genau ab, worum es geht, was die Frage ist, die derjenige an mich hat – damit es keine Arbeit ohne Auftrag wird. Das machen wir in der Medizin ganz gern, dass wir ein Problem sehen und das dann lösen wollen, aber es war eigentlich gar nicht der Wunsch des Patienten. Ich setze immer mindestens eine Stunde an, unter 90 Minuten wird es fast nie, weil ich erst mal verstehen will, was los ist, damit der Patient und ich den gleichen Film haben und wir genau wissen, worüber wir reden.
Im Gespräch gebe ich nie Antworten vor, sondern ich frage. Ich lasse Menschen auch aussprechen, was sie nicht aussprechen wollen, denn wo es am meisten weh tut, ist oft der größte Benefit für die Veränderung. Denn dann ist es nicht mehr unbewusst. Dann ist es ausgesprochen, dann ist es bewusst geworden und dann kann man es verändern. Wenn du merkst, irgendwas stimmt noch nicht, und wenn du das aufgelöst hast, dann brauchst du nicht viel Zeit, dann reicht meist ein Termin. Ich frage mich immer, ob ich wirklich tief genug gekommen oder eher an der Oberfläche bin. Denn solange es oberflächlich bleibt, fällt derjenige immer wieder in seine unbewussten Muster zurück.
DA: Die Kosten in der Ambulanz werden, wenn du dort das contextuelle Coaching mit einsetzt, ganz klassisch über die normale Krankenkassen-Versorgung übernommen. Wenn die Menschen extra zu dir kommen ins Coaching, wer übernimmt dann die Kosten?
Dr. Schaaf: Das ist eine gute Frage. Also, in der Ambulanz ist es tatsächlich so, wie du sagst. Das schreibe ich ja nicht extra auf, das mache ich automatisch in meiner Tätigkeit mit, denn es lohnt sich, weil der Rest schneller geht, sich die Termine verschlanken. Das heißt, da ist es in der normalen Ambulanz-Pauschale mit drin, weil das ja mein Beratungsgespräch ist.
Wie ich das führe, darf ich ja entscheiden. Wenn Menschen direkt zu mir kommen, handhabe ich es unterschiedlich. Es gab Krankenkassen, die das teil- oder sogar ganz erstattet haben, weil es ja ein Gesundheitscoaching ist. Ich habe dann geschrieben, es ist ein Gesundheitscoaching im Bereich Diabetes.
Es waren oft auch Menschen, die gesagt haben, ihnen sei eine Psychotherapie empfohlen worden, sie kriegen aber gar keinen Platz, und sie hätten, ehrlich gesagt, „nur“ „XY“-Herausforderung mit der Diagnose oder im Verlauf der Akzeptanz vom Diabetes. Dann habe ich gesagt, das können wir im Coaching machen – Psychotherapie würde erstattet, Coaching nicht beziehungsweise ich weiß es nicht, sie könnten es versuchen.
Meine Wunschvorstellung wäre tatsächlich, dass Krankenkassen – und man kann ja dann wirklich nach der Qualität gucken – das Coaching als Alternative zu einer Psychotherapie erstatten. Ich glaube, das würde unserem System wahnsinnig Kosten sparen, weil die Psychotherapie sehr langwierig ist.
DA: Wie organisierst du dieses Nebeneinander von Klinik-Tätigkeit und Coaching-Tätigkeit als Unternehmerin?
Dr. Schaaf: Es wäre mir sehr schwergefallen, meine Stelle in der Klinik aufzugeben, um nur noch im Coaching-Bereich zu arbeiten. Was ich auch mache, sind zum Beispiel Kommunikationskurse für die Diabetologen DDG, die vier- bis sechsmal im Jahr stattfinden. Das ist auch etwas, wo wir Bedarf haben. Ich habe gedacht, wenn ich das Wissen, was ich aus der Coaching-Ausbildung habe, an Kollegen, an Patienten bringe und die das dann selbst umsetzen, verändert sich was.
Mein Chef in der Klinik war ganz toll und hat überlegt, wie wir alles verbinden können. So habe ich reduziert und der Kollege, den ich ausgebildet habe, macht die Ambulanz weiter. Ich vertrete immer bei Urlaub, Krankheit, Fortbildungen und das planen wir immer fürs kommende Jahr.
DA: Würdest du deinen beruflichen Weg heute wieder genauso gehen?
Dr. Schaaf: Es war ja nicht geplant, so, wie es war, aber ich glaube, es war genau richtig. Hätte ich damals schon die Möglichkeiten gekannt, hätte ich den Weg, glaube ich, bewusst gewählt.
„Ich kenne das Wort Work-Life-Balance nicht, weil das bedeuten würde, dass Arbeit und Leben getrennt sind. Aber Work ist ja auch Leben – und es gilt, seine Arbeit so zu gestalten, dass das schon Spaß ist.“
DA: Bleibt dir bei deinen vielen Aufgaben und Tätigkeiten noch Zeit für anderes?
Dr. Schaaf: Ja! Das ist auch was, warum ich dieses Coaching so mag und was ich meinen Familien immer vermittle: ein bisschen das Denken zu ändern. Zum einen mich für das, was ich mache, wirklich bewusst zu entscheiden und das gern zu machen, weil das nämlich Lebensqualität ist. Ich kenne das Wort Work-Life-Balance nicht, weil das bedeuten würde, dass Arbeit und Leben getrennt sind. Aber Work ist ja auch Leben – und es gilt, seine Arbeit so zu gestalten, dass das schon Spaß ist.
Was ich aber auch viel mache: Ich reise total gern. Meinen Sport, den ich immer gemacht habe, musste ich ein bisschen einschränken, weil ich leider vor zwei Jahren einen schweren Motorradunfall hatte. Ich bin viel in der Natur, ich lese wahnsinnig viel, ich meditiere bestimmt anderthalb Stunden am Tag.
DA: Das klingt, als seist du einfach ein zufriedener Mensch.
Dr. Schaaf: Total, bin ich wirklich. Das ist auch, warum ich das so liebe, was ich mache, weil du tatsächlich, wenn du mit den Menschen hinguckst, etwas auflöst und sie dann zur Tür rausgehen und ein anderes Leben haben. Was ich zum Beispiel auch nicht mehr mache, ist, wenn jemand zu spät zu einem Termin kommt, mich darüber zu ärgern. Denn das Ärgern bringt nichts, zu spät ist er trotzdem – was ja unterschiedliche Gründe haben kann. Mit Ärgern verderbe ich mir nur den ganzen Tag.
DA: Super! Als ich dein Logo auf deiner Website drkatjaschaaf.de sah mit dem Schaf, dessen Körper wie eine Sprech- oder Denkblase aussieht, musste ich lachen. Wie kamst du auf dieses Logo?
Dr. Schaaf: Ich gar nicht. Derjenige, der die Website gestaltet hat, hat gesagt: „Weißt du was? Du brauchst ein cooles erkennbares Logo.“ Ich wollte das Schaf erst gar nicht haben, weil ich es ein bisschen kindisch und albern fand. Mittlerweile liebe ich es.
DA: Wenn du dir konkret etwas für die Zukunft für Kinder und Jugendliche mit Diabetes wünschen dürftest, was wäre dein größter Wunsch?
Dr. Schaaf: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Kommunikation sich noch mal verändert. Was Kinder und Jugendliche auch ganz oft berichten, ist Unwissenheit ihrer Mitmenschen und, dass sie auch Mobbing-Erfahrungen machen, doofe Sprüche und so.
Da wünsche ich mir, dass Menschen, die nicht wissen, wovon sie reden, sich ein bisschen mehr Fakten holen, bevor sie urteilen – und auf der anderen Seite, dass die Kinder und Jugendlichen vielleicht durch eine Art Coaching – man könnte das ja sogar als Trainingskurs machen – lernen, anders damit umzugehen, damit sie das, was im Außen passiert, nicht so auf sich beziehen. Damit sie wirklich, egal ob es jetzt Diabetes ist, egal welche Erfahrungen sie machen, das als Chance für sich umwandeln können und eine andere Lebensqualität entwickeln.
DA: Ganz herzlichen Dank, Katja!
Interview: Dr. med. Katrin Kraatz
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Bewegung
Faschingszeit: Gute Vorsätze – mit kurzer Pause
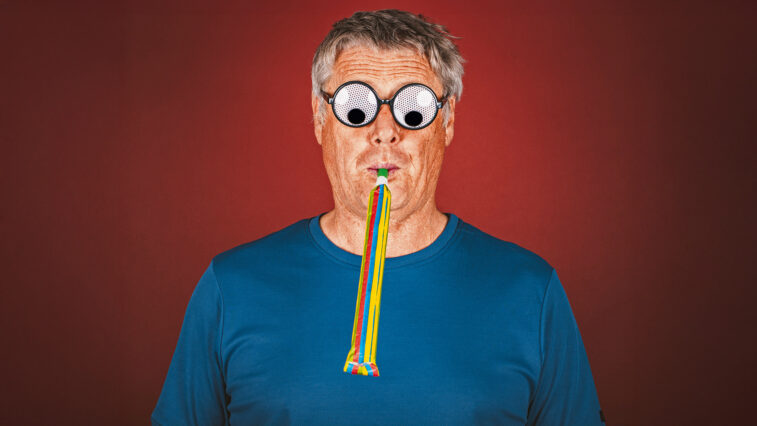
2 Minuten
- Behandlung
Mit Diabetes gut vorbereitet ins Krankenhaus: Was muss mit, was vorab geklärt werden?

5 Minuten
Keine Kommentare
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
laila postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 13 Stunden, 7 Minuten
Hallo ihr Lieben….Mein Name ist Laila…Ich bin neu hier…Ich wurde seit 2017 mit Diabetes 2 diagnostiziert.Da bekam ich den Diabetes durch laufen ohne Medies in den Griff.Das ging so bis Januar 2025.Ich weiss heute nochicht warum…aber ich hatte 2024 den Diabetes total ignoriert und fröhlich darauf losgegessen.Mitte 2025 ging ich Sport machen und gehen nach dem Essen.Und nahm immer megr ab.Htte einen Hb1C Wert von 8…Da ich abnahm, dachte ich, das der Wert besser ist…Bis Januar 2025…Da hatte ich einen HbA1C Wert von 14,8…Also Krankenhaus und Humalog 100 zu den Malzeiten spritzen…Und Toujeo 6 EI am Morgen…Irgendwann merkte ich, das mich kein Krankenhaus einstellen konnte.Die Insulineinheiten wurden immer weniger.Konnte kein Korrekturspritzen megr vornehmen.Zum Schluss gin ich nach 5 Mon. mit 2 Insulineinheiten in den Hypo…Lange Rede …kurzer Sinn.Ich ging dann auf Metformin…Also Siofor 500…Ich war bei vielen Diabethologen….Die haben mich als Typ 1 behandelt.Mit Metformin ging es mir besser.Meine letzte Diaethologin möchte, das ich wieder spritze.Ich komme mit ihr garnicht zurecht.Mein HbA1C liegt jetztbei 6,5…Mein Problem ist mein Gewicht.Ich wiege ungefähr 48 Kilo bei 160 m…Ich bräuchte dringend Austausch…Habe so viele Fragen…Bin auch psychisch total am Ende. Achso…Ja ich habe seit 1991 eine chronisch kalfizierende Pankreatitis…Und eine exokrine Pankreasinsuffizienz…Also daurch den Diabetes 3c.Wer möchte sich gerne mit mir austauschen?An Michael Bender:” Ich habe Deine Geschichte gelesen . Würde mich auch gerne mit Dir austauschen, da Du ja auch eine längere Zeit Metformin eingenommen hast.” Ich bin für jeden, mit dem ich mich hier austauschen kann, sehr dankbar. dankbar..Bitte meldet Euch…!!!
-
suzana antwortete vor 11 Stunden, 14 Minuten
Hallo Leila, ich bin Suzana und auch in dieser Gruppe. Meine Geschichte kannst du etwas weiter unten lesen.
Es ist sicher schwer aus der Ferne Ratschläge zugeben, dennoch: ich habe mich lange gegen Insulinspritzen gewehrt aber dann eingesehen, dass es besser ist. Wenn die Pankreas nicht mehr genug produziert ist es mit Medikamenten nicht zu machen. Als ich nach langer Zeit Metformin abgesetzt habe, habe ich erst gemerkt, welche Nebenwirkungen ich damit hatte.
Ja auch ich muss aufpassen nicht in den unterzucker zu kommen bei Sport und Bewegung aber damit habe ich mich inzwischen arrangiert. Traubensaft ist mein bester Freund.
Ganz wichtig ist aber ein DiabetologIn wo du dich gut aufgehoben fühlst und die Fragen zwischendurch beantwortet.
Weiterhin viel Kraft und gute Wegbegleiter! -
laila antwortete vor 8 Stunden, 36 Minuten
@suzana: Ich danke Dir für die Nachricht.Könnten wir uns weiterhin austauschen?Es wäre so wichtig für mich.Vielleicht auch privat? Gebe mir bitte Bescheid…Ich kenne mich hier leider nicht so gut aus…Wäre echt super…😊
-
-
vio1978 postete ein Update vor 1 Tag, 23 Stunden
Habe wieder Freestyle Libre Sensor, weil ich damit besser zurecht kam als mit dem Dexcom G 6. ist es abzusehen, ob und wann Libre mit d. Omnipod-Pumpe kompatibel ist?🍀
-
renrew postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes-Technik vor 1 Woche, 1 Tag
gibt es Tips oder Ratschläge dieser Pumpe betreffend?
-
moira antwortete vor 5 Tagen, 15 Stunden
Das kommt sehr darauf an – in welchem Bereich?
-








