4 Minuten
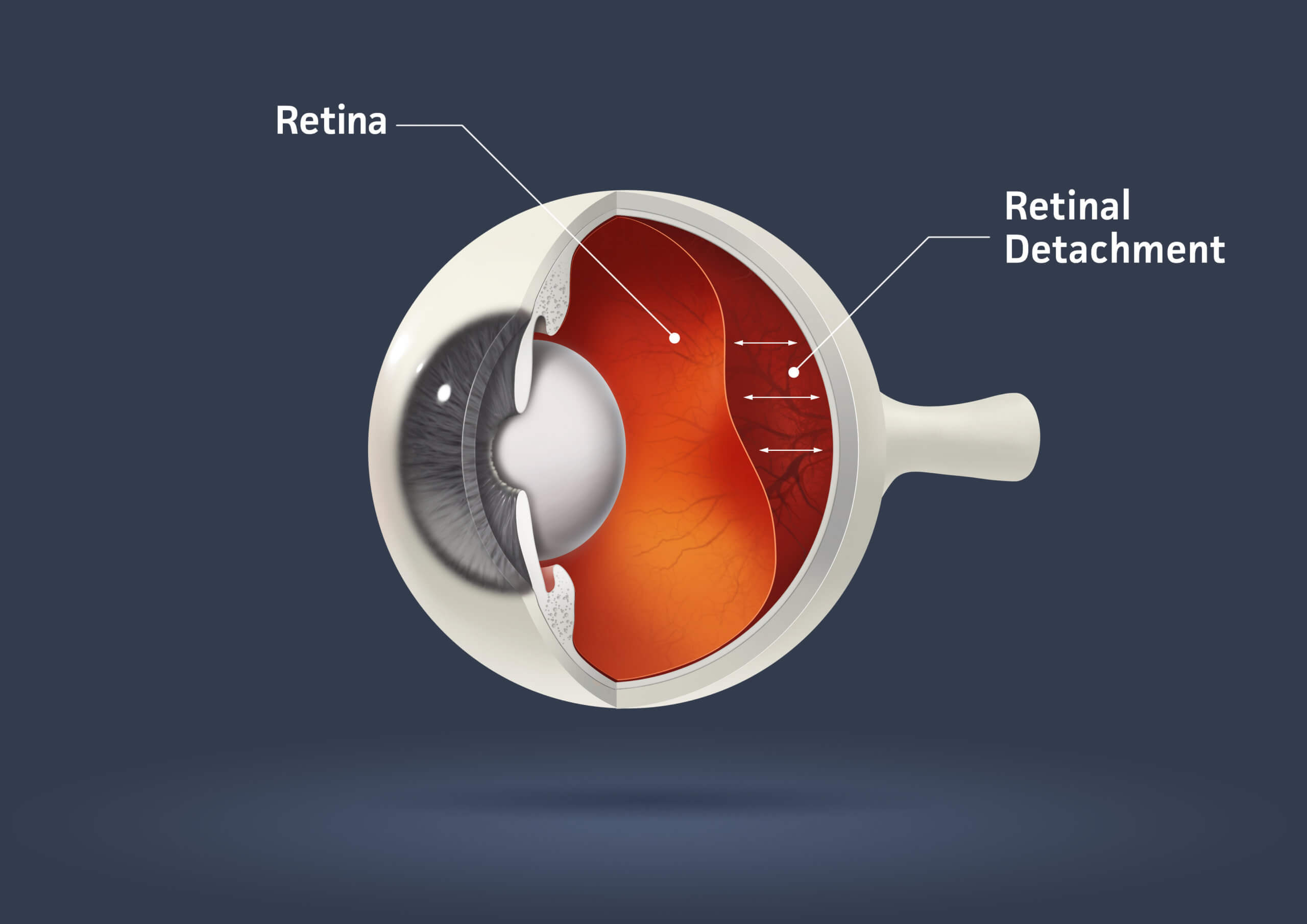
Man kann es einfach nicht beschönigen: Die Pubertät war für mich und auch für meinen Diabetes eine schwere Zeit. Selbst meine Mama sagt heute: „Das war die schwerste Zeit in meinem Leben.“ Ja, ich war wirklich nicht einfach. Heute, mit zunehmendem Alter, etwas mehr Weitsicht und mehr und mehr Zeit, die vergeht, kann ich mir das offen und ehrlich eingestehen. Im Prinzip könnte man fast über meine pubertären Eskapaden lachen, wenn einige nicht sogar fast lebensgefährlich gewesen wären.
Aber mal von Anfang an. Als ich die Diagnose Typ-1-Diabetes bekam, war ich 10 Jahre alt, noch ein Kind. Da mein großer Bruder ebenfalls Typ-1-Diabetes hat, wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Zumindest war der Diabetes in keiner Weise angsteinflößend. Ich sah all das eher als Abenteuer. Schließlich war mein Bruder in meinen Augen ein ganz normaler, gesunder junger Mensch, der mitten im Leben stand.

Das an der ganzen Diabetes-Sache doch etwas mehr dran ist als Spritzenaufziehen und sich in den Finger zu piksen, wurde mir erst in der Pubertät bewusst. Als die Hormone anfingen, ihre Arbeit zu leisten, wurde mein Diabetes schwer einstellbar. Es folgten eine Reihe Arztbesuche, Insulinwechsel, Versuche mit neuen Therapiemöglichkeiten und Krankenhausbesuche zur Neueinstellung.
Fand ich es vorher noch ziemlich cool, wie ein Arzt meine Spritzen aufzuziehen und andere mit meinen Blutstropfen zu beeindrucken, so wollte ich in der Pubertät nur noch eins sein: normal!
Na gut, ich wollte schon irgendwie auffallen, aber nicht, weil ich krank oder vielleicht sogar eingeschränkt sein könnte. So tauschte ich Blutzuckermessgerät und meinen Pen gegen knallbunte Haare und Springerstiefel. Ja, richtig gehört. Irgendwann blieb mein Blutzuckermessgerät einfach zu Hause. Ich testete meinen Blutzucker in der Schule kaum noch. Und auch das Spritzen wurde in der Öffentlichkeit immer weniger. Mit der Zeit verlor ich immer mehr das Interesse an meinem Diabetes. Ich hatte auf den Diabetes genauso wenig Lust wie auf die Schule. Wie meine Klassenkameraden wollte ich unbeschwert auf Partys und Konzerte gehen. Keine Lust, über so ernste Themen wie Diabetes nachzudenken. Dass das gefährlich werden kann, brauche ich euch wohl nicht zu verraten.

Auch meine Eltern und Ärzte merkten immer mehr, dass ich abdriftete. Ständig versuchten meine Eltern, wieder einen Zugang zu finden – etwas mehr Kontrolle über ihr Kind zu bekommen. „Wie sind deine Werte?“, war wohl die häufigste Frage meiner Eltern und die, die mich so richtig aggressiv werden ließ. Patzig antwortete ich stets: „Die sind gut…“, und verließ schnell den Raum. „Aber du riechst nach Aceton!“ „Das kann gar nicht sein!“ Und schon wieder war ich weg. Meine Eltern fühlten sich hilflos. So hilflos, dass sie mich jede Oster- und Herbstferien auf Diabetesfreizeiten oder zur Neueinstellung ins Krankenhaus schickten. Doch da fanden die Ärzte genauso wenig einen Zugang zu mir. Natürlich machte ich die zwei Wochen genau das, was erwartet wurde, nur, um zu Hause sofort wieder in alte Muster zurückzufallen, auf den Kopf war ich schließlich nicht gefallen. Ich wollte eben nur meine Ruhe.
Dass auch meine Blutzuckertagebücher gefälscht waren, war meinen Ärzten und Eltern ebenfalls bewusst. „Die Werte stimmen überhaupt nicht mit deinem HbA1c-Wert überein“, der Ärger beim Diabetologen war wirklich groß. Trotzdem fälschte ich weiter meine Werte und ließ mir weder von Eltern noch von Ärzten etwas sagen. „Lebt ihr erstmal mit dieser * Krankheit! Da könnt ihr noch so viel studiert und gelesen haben… ihr wisst nicht, wie es ist, damit zu leben!“
Ich sage ja, ich war damals sehr melodramatisch, aber im Prinzip war es genau das, was ich fühlte: unverstanden und weniger wichtig, denn immer ging es nur um den Diabetes und meine Werte, aber nie um mich oder meine Gefühlswelt. Ich hatte auf gut Deutsch damals die Schnauze einfach voll.
Meine Ablehnung ging so weit, dass ich mit 18 Jahren, als ich endlich alleine zum Arzt fahren konnte, nicht mehr hinfuhr. Es dauerte noch ein paar Jahre, bis ich endlich einsehen konnte, dass mein Verhalten für lange Zeit sehr selbstzerstörerisch war. Um wirklich gut und so normal wie möglich leben zu können, darf ich meinen Diabetes nicht ignorieren. Nein, ich muss ihn therapieren und in meinen Alltag integrieren. All das musste ich von Neuem lernen, auch musste ich lernen, meinen Diabetes wieder als einen Teil von mir zu akzeptieren – und ich brauchte dringend einen neuen Arzt.

All das habe ich in die Hand genommen und bin heute nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit meinem Diabetes im Reinen. Ich denke, solche Trotzphasen können jedem passieren. Besonders in der Pubertät. Die ist auch ohne Diabetes schon oft eine schwere Zeit, mit einer chronischen Krankheit wird es nun mal nicht leichter. Aber es wird leichter, wenn man seinen Diabetes akzeptiert und auf ihn und den eigenen Körper achtgibt. Aber das Allerwichtigste, das ich gelernt habe: Ich bin nicht alleine. So wie mir geht es ganz vielen da draußen. Da gibt es Menschen, die mich verstehen, die sich mit mir austauschen und dir mir zeigen: Du bist ganz normal. Auch die schlechten Phasen sind ganz normal. Hier ist niemand schwach, weil er mal eine Pause vom Diabetes benötigt. Hier ist niemand verrückt, weil er manchmal genervt vom Diabetes-Alltag ist.
Diabetes in der Pubertät (Podcast) – Über das Thema Pubertät hat Lisa auch schon einmal im Podcast mit Ramona gesprochen!

4 Minuten
3 Minuten
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Beliebte Themen
Ernährung
Aus der Community
Push-Benachrichtigungen
