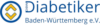- Behandlung
pAVK: Stehenbleiben wegen Schmerzen
5 Minuten

Bei der Schaufensterkrankheit handelt es sich nicht um ein modernes Einkaufsverhalten, den „Shoppingwahn“, sondern um eine immer häufiger auftretende Erkrankung vor allem der Beinarterien der Menschen – mit schwerwiegenden Folgen. Im Diabetes-Kurs klärt Dr. Schmeisl auf.
Der Fall
Peter M. ist 75 Jahre alt und hat vor 8 Jahren rechts schon eine „neue Hüfte“ bekommen. Seit einigen Monaten hat er insbesondere beim Gehen nach einigen 100 Metern jetzt Schmerzen im linken Bein. Der Hausarzt vermutet nun auch eine Hüft-Arthrose links und schickt ihn zum Orthopäden und zum Röntgen.
Der Orthopäde findet jedoch ein gesundes linkes Hüftgelenk. Schließlich kommt sein Hausarzt noch auf die Idee (Peter M. war 40 Jahre lang starker Raucher), es könnte auch eine Durchblutungsstörung sein. Eine Gefäßuntersuchung schließlich bestätigt eine Beckenarterienstenose links, die mit Aufdehnung und Stent behandelt werden kann. Peter M. ist seitdem beschwerdefrei und raucht nie wieder, wie er sagt.
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK), genannt „Schaufensterkrankheit“, ist eine Erkrankung, die viele Menschen dazu zwingt, beim Gehen immer wieder nach kurzer Distanz stehen zu bleiben. Deshalb erfolgt die medizinische Einteilung der pAVK nach der Entfernung, die die Menschen gehen können. In Deutschland sind etwa 4,5 Mio. Menschen betroffen; Männer trifft es häufiger als Frauen.
Diese Patienten haben ein 4-fach erhöhtes Risiko für einen Herzinfarkt sowie ein bis zu 3-fach erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall. Die Krankheit nimmt mit dem Alter rapide zu, gerade bei Menschen über 65 Jahren. Nach Schätzungen ist etwa jeder 4. Patient über 55 Jahre alt.
Die typischen Symptome
Gefäßerkrankungen betreffen meist den ganzen Körper – im Fall der pAVK besonders die großen Arterien im Bereich des Beckens und der Beine. Die Gefäßerkrankungen sind in über 95 Prozent bedingt durch Fettablagerungen mit zusätzlichen Verkalkungen. Durchblutungsstörungen der Arme und Hände sind viel seltener.
Die Lebenserwartung von Menschen mit einer pAVK ist ca. 10 Jahre geringer als bei Vergleichspersonen ohne pAVK! Etwa 50 bis 70 Prozent der pAVK-Patienten sterben vorzeitig am Herzinfarkt, 10 bis 20 Prozent erleiden einen Schlaganfall, und 10 bis 20 Prozent sterben durch andere Gefäßkomplikationen (z. B. gerissenes Aneurysma an der Hauptschlagader).
Am Anfang ohne Schmerz
Typisch ist, dass die pAVK am Anfang schmerzlos ist, die Beschwerden kommen oft schleichend. In der großen, deutschlandweit angelegten Studie „GetAbi“ konnte gezeigt werden, dass jeder 5. der beim Hausarzt Untersuchten eine Schaufensterkrankheit im beginnenden oder sogar fortgeschrittenen Stadium hatte, ohne davon etwas zu ahnen. Teils starke, krampfartige Schmerzen in der Wade (gelegentlich auch im Fuß, im Oberschenkel, im Po) treten erst auf, wenn die Betroffenen beim Gehen vor allem im Unter- und Oberschenkelmuskel mehr Blut und damit mehr Sauerstoff brauchen, aber nicht bekommen.
Aber nur einer von 10 Patienten hat die typischen Schmerzen, die der Krankheit den Namen gaben: Die Betroffenen bleiben vor Schaufenstern stehen, angeblich aus Interesse an der Auslage – Grund sind aber die Schmerzen im den Beinen. Viele Menschen haben mit zunehmendem Alter auch Wirbelsäulenprobleme, so dass die „pAVK-Beschwerden“ oft nicht als arterielle Durchblutungsstörungen erkannt oder eingestuft werden.
Die Gehstrecke nimmt ab
Typischerweise nimmt mit den Jahren die Strecke ab, die ein Betroffener ohne Schmerzen gehen kann – sie können sich aber auch weiterentwickeln bis hin zum „Ruheschmerz“. Manchmal treten auch ohne größere Vorboten Geschwüre am Fuß auf, die schlecht heilen.
Besteht zusätzlich eine diabetische Nervenerkrankung (Polyneuropathie), so geschieht dies oft ohne jegliche Schmerzen: Es drohen eine kritische Durchblutungsstörung, Infektion und Amputation. Von ca. 65.000 Amputationen in Deutschland jährlich betreffen etwa 40.000 Menschen mit Diabetes. Etwa 40 Prozent aller Patienten mit pAVK haben Diabetes; etwa die Hälfte aller Menschen mit schweren Durchblutungsstörungen hat Diabetes.
periphere arterielle Verschlusskrankheit: Stadien |
|
| Stadium I | trotz vorhandener Engstellen der Gefäße keine Beschwerden oder Beschwerden bzw. Missempfindungen nur bei höherer Belastung |
| Stadium II | Hinken/Stehenbleiben („Claudicatio intermittens“); IIa: Schmerzen treten bei einer Strecke von mehr als 200 m auf, IIb: Schmerzen treten bei einer Strecke von weniger als 200 m auf |
| Stadium III | Schmerzen bereits im Ruhezustand, besonders auch nachts |
| Stadium IV | meist offene Wunden oder schlecht heilende Wunden durch untergegangenes Gewebe („Nekrose“) |
Es gibt einen engen Zusammenhang mit der pAVK und dem Auftreten einer koronaren Herzkrankheit (KHK) sowie dem Risiko für einen Schlaganfall. Die pAVK ist also eine Art „Marker-Erkrankung“, die den Gesamtzustand des Gefäßsystems eines Menschen widerspiegelt – sie ist meist Ausdruck eines erhöhten generalisierten Risikos für schwerwiegende Durchblutungsstörungen.
Ablagerungen als Hauptursache
Meist liegt der Erkrankung eine Ablagerung des schlechten Cholesterins (LDL-Cholesterins) in den inneren Arterienwänden zugrunde. Im Verlauf der Erkrankung wird darin zusätzlich Kalk eingelagert, was die Gefäßinnenwand schädigt. Diabetes und Rauchen fördern zusätzlich diese „Endothel-Schädigung“. Die Gefäßwände werden immer starrer, schließlich immer enger und somit auch die Blutversorgung (also auch die Sauerstoffversorgung) immer schlechter.
Die Risikofaktoren für eine „pAVK“:
- Diabetes mellitus, vor allem Typ 2
- Übergewicht, Adipositas
- gestörter Fettstoffwechsel (vor allem zu hohes LDL-Cholesterin)
- Bluthochdruck
- Rauchen
So erkennt man die Verschlusskrankheit
Der Knöchel-Arm-Index (ankle-brachial index, ABI) ist ein einfacher Test, bei dem der Blutdruck mittels einer Manschette am Fußknöchel und am Oberarm gemessen und ins Verhältnis gesetzt wird. Der Index kann Hinweise auf eine Durchblutungsstörung an den Beinen geben. Normalerweise ist der Druck an den Füßen höher als am Arm. Ist dies nicht der Fall, kann je nach Ausprägung eine schwerwiegende arterielle Durchblutungsstörung vorliegen, die dann durch weitere Untersuchungen bestätigt werden muss (wie Gefäß-Duplex- oder Farbduplex-Untersuchung, evtl. Röntgen).
Menschen mit Diabetes haben öfter auch abschnittsweise an den Blutgefäßen eine „Mediasklerose“. Diese Verkalkung der Muskelschicht führt dazu, dass der Blutdruck nicht zuverlässig gemessen werden kann, weil die Gefäßwände zu starr sind; die Druckwerte sind dann zu hoch. In diesem Fall ist der Messwert nicht für die Diagnostik verwertbar.
Weiterführende Techniken sind:
- Duplex-/Farbduplex-Ultraschall,
- Magnet-Resonanz-Angiographie (MRA),
- Computer-Tomographie (CT),
- Angiographie (Gefäßdarstellung mit Kontrastmittelgabe).
So wird behandelt …
Zunächst stehen einfache konservative Maßnahmen im Vordergrund, denn wie alle Studien zeigen, haben fast 80 Prozent aller Patienten mindestens zwei der oben genannten Risikofaktoren.
Gesicherte konservative Behandlung:
- regelmäßiges Gehtraining (Gefäßsport von 30 bis 40 Minuten),
- normale, gesunde Ernährung (kalorienreduzierte Ernährung),
- Einstellen des Rauchens,
- medikamentöses Senken des LDL-Cholesterins (z. B. mit CSE-Hemmern),
- gute, aber nicht zu niedrige Einstellung des Blutdrucks,
- bei Diabetes weniger gewichtsfördernde Medikamente (z.B. Sulfonylharnstoffe) nehmen und evtl. auf darmhormonbasierte Medikamente umsteigen wie GLP-1-Agonisten, DPP-4-Hemmer, SGLT-2-Hemmer und Metformin,
Blutplättchenhemmer (ASS, Clopidogrel), - evtl. in Zukunft auch andere Gerinnungshemmer (z. B. Faktor-Xa-Hemmer).
Was tun, wenn all dies nicht ausreicht?
Wenn trotz all der Maßnahmen ein Bein z. B. durch eine schwere arterielle Durchblutungsstörung akut gefährdet ist, muss die Durchblutung durch einen Eingriff sofort wiederhergestellt werden.
Dazu gibt es verschiedene vom Einzelbefund des Patienten abhängige Verfahren, die alle ihre Bedeutung haben:
- Es gibt die Aufdehnung mit einem Ballon (PTA: perkutane transluminare Angioplastie) und evtl. Stent (Gefäßstütze).
- Mittels eines Gefäßbypasses kann ein Umgehungskreislauf „gebastelt“ werden, unter Verwendung eines Stücks eigener Vene, meist aus dem Oberschenkel oder auch Unterschenkel, oder eines „Kunststoff-Gefäßes“ (PTFE-Bypass).
Weitere Verfahren sind:
- TEA (Thrombendarteriektomie), um große Verkalkungen auszuschälen,
- Lyse-Therapie zur Auflösung eines Gerinnsels an einer bestimmten Stelle.
Wie zuvor schon gesagt, hängt der Erfolg auch dieser Maßnahmen davon ab, wie konsequent der Betroffene ab dann Risikofaktoren vermeidet und vor allem Gehtraining durchführt.
Die Zusammenfassung
Die periphere arterielle Verschlusskrankheit, auch Schaufensterkrankheit genannt, ist nicht rückgängig zu machen. Man kann jedoch sehr viel erreichen, um die örtliche Durchblutung wiederherzustellen und die Arteriosklerose soweit möglich zu bremsen. Dazu müssen die Risikofaktoren ausgeschaltet werden, insbesondere das Rauchen. Hinzu kommt heutzutage die Gabe von Thrombozytenaggregationshemmern und/oder Gerinnungshemmern.
Autor:
|
|
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2018; 67 (10) Seite 30-33
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Technik
Darauf ist zu achten: Sicher mit dem Insulinpen umgehen

3 Minuten
- Bewegung
Faschingszeit: Gute Vorsätze – mit kurzer Pause
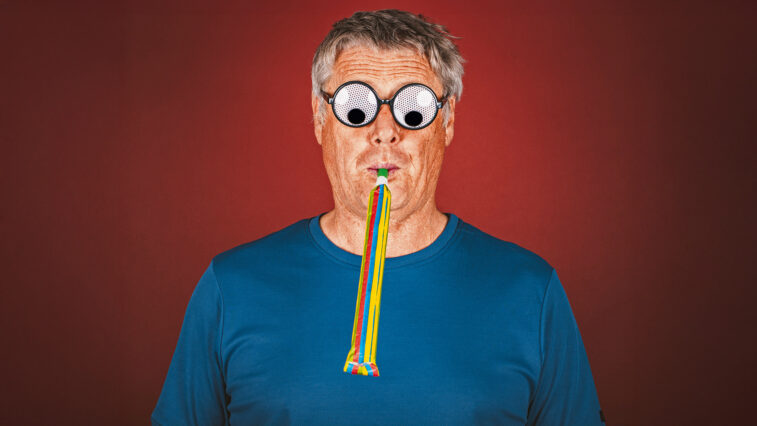
2 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 9 Stunden, 37 Minuten
Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!
-
wolfgang65 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 1 Tag, 5 Stunden
Liebe Leute, ich habe zwei neue Erfahrungen mach dürfen, die Ursächliche nicht so schön, woraus die 2. Erfahrung (notwendig gut) resultiert!
Ich bin kein Liebhaber von Zahnärzten und meine dort geführte Gesundheitsakte ist mit einem riesigen “A” für Angspatient gezeichnet. Ende letzten Jahres ist mir beim letzten verbleibenden Weisheitszahn (nie Schmerzen gemacht) größeres Teil abgebrochen, ZA meint, da geht er nicht bei, weil Zahn quer liegt, allso OP, und danach könnte man sich über Zahnersatz unterhalten … ich natürlich in Schockstarre gefallen, – gleich am selben Tag bei OP-Zahnarzt Termin gemacht, vor Weihnachten nix mehr möglich, gleich Anfang Januar Termin bekommen, Röntgenbild lag dem Chirugen bereits vor. Vieles wurde besprochen, auch der Zahnersatz, wobei der Chirug gleich meinte, dass ausser WZ wohl 3 weitere Zähne raus müssten. Schock nr. 2! Ich wollte mir aber noch 2Meinung einholen und fand Dank guten Rat von Bekannten, einen anderen Zahnarzt, dem ich mein Leid und Angst ausführlich schildern konnte und der auch zum erstenmal die Diabetes in Spiel brachte … kurz um ein bisher bestes aufklärendes Gespräch, wie weit Diabetes auch auf die Zahne und Zahnfleisch gehen kann. Bei mir Fazit Paradontites. (die 1. unschöne Erfahrung). Der Weisheits- und daneben liegende Zahn sind inzwischen raus, – war super gute und schmerzfreie OP, danach keinerlei Schmerzen, durfte allerdings auch Antibiotika nehmen. Die 2. Erfahrung: ich konnte meine Insulindosies halbieren, – bei 10 Tg. Antbiotika, und nun 15 ohne Medizin noch anhaltend niedrige Insulinmenge, mit steigender festen Nahrungsaufnahme.
Heute bei Diabetologen bestätigt, das Diabetiker besonders auf Ihre Zähne und Zahlfleich achten sollten. Da frage ich mich warum der Zahnarzt da nicht im Vorsorgekatalog von DMP aufgenommen ist.
LG Wolfgang
-
laila postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 2 Tagen
Hallo ihr Lieben….Mein Name ist Laila…Ich bin neu hier…Ich wurde seit 2017 mit Diabetes 2 diagnostiziert.Da bekam ich den Diabetes durch laufen ohne Medies in den Griff.Das ging so bis Januar 2025.Ich weiss heute nochicht warum…aber ich hatte 2024 den Diabetes total ignoriert und fröhlich darauf losgegessen.Mitte 2025 ging ich Sport machen und gehen nach dem Essen.Und nahm immer megr ab.Htte einen Hb1C Wert von 8…Da ich abnahm, dachte ich, das der Wert besser ist…Bis Januar 2025…Da hatte ich einen HbA1C Wert von 14,8…Also Krankenhaus und Humalog 100 zu den Malzeiten spritzen…Und Toujeo 6 EI am Morgen…Irgendwann merkte ich, das mich kein Krankenhaus einstellen konnte.Die Insulineinheiten wurden immer weniger.Konnte kein Korrekturspritzen megr vornehmen.Zum Schluss gin ich nach 5 Mon. mit 2 Insulineinheiten in den Hypo…Lange Rede …kurzer Sinn.Ich ging dann auf Metformin…Also Siofor 500…Ich war bei vielen Diabethologen….Die haben mich als Typ 1 behandelt.Mit Metformin ging es mir besser.Meine letzte Diaethologin möchte, das ich wieder spritze.Ich komme mit ihr garnicht zurecht.Mein HbA1C liegt jetztbei 6,5…Mein Problem ist mein Gewicht.Ich wiege ungefähr 48 Kilo bei 160 m…Ich bräuchte dringend Austausch…Habe so viele Fragen…Bin auch psychisch total am Ende. Achso…Ja ich habe seit 1991 eine chronisch kalfizierende Pankreatitis…Und eine exokrine Pankreasinsuffizienz…Also daurch den Diabetes 3c.Wer möchte sich gerne mit mir austauschen?An Michael Bender:” Ich habe Deine Geschichte gelesen . Würde mich auch gerne mit Dir austauschen, da Du ja auch eine längere Zeit Metformin eingenommen hast.” Ich bin für jeden, mit dem ich mich hier austauschen kann, sehr dankbar. dankbar..Bitte meldet Euch…!!!
-
suzana antwortete vor 1 Tag, 22 Stunden
Hallo Leila, ich bin Suzana und auch in dieser Gruppe. Meine Geschichte kannst du etwas weiter unten lesen.
Es ist sicher schwer aus der Ferne Ratschläge zugeben, dennoch: ich habe mich lange gegen Insulinspritzen gewehrt aber dann eingesehen, dass es besser ist. Wenn die Pankreas nicht mehr genug produziert ist es mit Medikamenten nicht zu machen. Als ich nach langer Zeit Metformin abgesetzt habe, habe ich erst gemerkt, welche Nebenwirkungen ich damit hatte.
Ja auch ich muss aufpassen nicht in den unterzucker zu kommen bei Sport und Bewegung aber damit habe ich mich inzwischen arrangiert. Traubensaft ist mein bester Freund.
Ganz wichtig ist aber ein DiabetologIn wo du dich gut aufgehoben fühlst und die Fragen zwischendurch beantwortet.
Weiterhin viel Kraft und gute Wegbegleiter! -
laila antwortete vor 1 Tag, 19 Stunden
@suzana: Ich danke Dir für die Nachricht.Könnten wir uns weiterhin austauschen?Es wäre so wichtig für mich.Vielleicht auch privat? Gebe mir bitte Bescheid…Ich kenne mich hier leider nicht so gut aus…Wäre echt super…😊
-
wolfgang65 antwortete vor 1 Tag, 5 Stunden
Hallo Leila, auch von mir ein herzliches willkommen. Auch meine Geschichte liest du im weiteren Verlauf.
Zur “chronisch kalfizierende Pankreatitis” kann ich nix sagen, da ist immer das Gespräch mit dem Arzt/Diabetologen vorzuziehen, wie in allen Gesundheitsfragen. Was sagen Ärzte dazu, auch wg. der NICHTzunahme an Gewicht. Wenn ich mit einem Arzt nicht kann, oder dieser mir nicht ausreichende Infos gibt, schaue ich mich nach einem anderen Arzt/Diabetologen um, das ist Dein Recht, es geht um Deine Gesundheit!
Sollte mit der Nichtzunahme noch mehr dahinter Stecken, vielleicht
auch mal einen Psychologen in Deine Überlegung ziehen. Oder eine auf dich zugeschnittene Diabetes Schulung o.Ä., auch hier sollte Dich ein guter Diabetologe aufklären können.Soweit was mir im Moment einfällt. Lass es Dir gut gehen.
Gruss Wolfgang
-
michatype3 antwortete vor 1 Tag, 5 Stunden
Hey Laila, du kannst mir gerne hier im Typ 3c Bereich oder via PN schreiben. Ich bin gerade zwar etwas gesundheitlich angeschlagen, versuche aber, so gut es geht zu antworten.
-