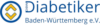- Behandlung
Startschuss für Patientensicherheitsoffensive
5 Minuten

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS) und der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) haben heute gemeinsam mit dem Autor Prof. Dr. Matthias Schrappe von der Universität Köln das „Weißbuch Patientensicherheit“ in Berlin vorgestellt. Darin werden unter anderem ein erweitertes Verständnis von Patientensicherheit, eine Patientensicherheitskultur in allen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie eine aktive Einbindung der Patientinnen und Patienten gefordert. APS und vdek formulierten zudem sieben konkrete Forderungen und rufen zu einer Patientensicherheitsoffensive auf.
In Sachen Patientensicherheit sei in den letzten Jahren schon einiges erreicht worden, betonten die Beteiligten: OP-Checklisten, Aktion Saubere Hände, Fehlermeldesysteme oder ein verpflichtendes Qualitätsmanagement in deutschen Krankenhäusern seien gute Beispiele für dieses wachsende Bewusstsein und Engagement. Dennoch gebe es erheblichen weiteren Verbesserungsbedarf in allen Bereichen des Gesundheitswesens.
In Krankenhäusern verlaufen beispielsweise 90 bis 95 Prozent aller Krankenhausbehandlungen ohne Zwischenfälle. Bei fünf bis zehn Prozent (ein bis zwei Millionen Patienten) pro Jahr treten dagegen „unerwünschte Ereignisse“ auf, von Drückgeschwüren über Fehldiagnosen bis hin zu schweren Infektionen. Vermeidbar wären bis zu 800.000 dieser „unerwünschten Ereignisse“.
„Patientensicherheit ist mehr als die Vermeidung bestimmter Komplikationen“
Patientensicherheit werde heute fast ausschließlich aus der Perspektive der Einrichtungen und für operative Akuterkrankungen, wie zum Beispiel der Komplikationen einer „Hüft-OP“, diskutiert. Patientensicherheit ist jedoch mehr als die Vermeidung bestimmter Komplikationen“, so Prof. Dr. Schrappe. „Sie muss auch als Eigenschaft von Teams, Organisationen und sogar des gesamten Gesundheitswesens verstanden werden. Ihre Innovationskraft ist in den Dienst der Verwirklichung dieses Ziels zu stellen.“ „Wir stellen bei unseren Bemühungen um Patientensicherheit die Patientenperspektive in den Mittelpunkt“, sagte Hedwig François-Kettner, Vorsitzende des APS.
„Patienten und Angehörige müssen als aktive Partner in die Verbesserung der Patientensicherheit einbezogen werden.“ Das APS hatte das Projekt der Erstellung des Weißbuchs ins Leben gerufen und intensiv begleitet. Im Rahmen der Patientensicherheitsoffensive fordert das APS unter anderem, dass Patientensicherheit fester Bestandteil der Aus- und Weiterbildung aller im Gesundheitswesen Tätigen wird und Verantwortliche für Patientensicherheit eingerichtet werden. „Es muss allen klar werden, dass Patientensicherheit Führungsverantwortung ist“, ergänzte François-Kettner. „Die gute Nachricht ist: Patientensicherheit ist kein Kosten-, sondern ein Erfolgsfaktor!“
Handlungsbedarf insbesondere im Bereich der Hygiene und Infektionsprävention
„Für die Verbesserung der Versorgungsqualität und Patientensicherheit setzen sich die Ersatzkassen seit Jahren ein“, sagte Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des vdek. „Dieses Engagement in Sachen Qualität wollen wir fortführen und fördern daher das Projekt Weißbuch.“ Handlungsbedarf sieht Elsner insbesondere im Bereich der Hygiene und Infektionsprävention. Im Forderungspapier von APS und vdek finden sich hierzu Maßnahmen von einer bundeseinheitlichen Hygienerichtlinie bis zu einer Aufklärungskampagne der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Sepsis als Notfall.
Zudem forderte Elsner die verpflichtende Einführung von einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen an allen Krankenhäusern sowie die Einbeziehung der Erfahrungen von Patienten und Angehörigen durch Fragebögen, um Fehlerquellen aufzudecken. Zudem sei die Einführung eines Implantateregisters für sämtliche Hochrisikomedizinprodukte (etwa Herzklappen) längst überfällig.
Die komplette Version des APS-Weißbuchs Patientensicherheit sowie eine englische und deutsche Kurzfassung sind ab sofort kostenfrei verfügbar unter: www.aps-ev.de/aps-weissbuch.
Patientensicherheitsoffensive von APS, vdek und Ersatzkassen:
Sieben konkrete Forderungen für mehr Patientensicherheit
Die Gesundheitsversorgung in Deutschland ist eine der besten der Welt. Gerade bei der Patientensicherheit gibt es aber weiter Verbesserungsbedarf. Beispiel Krankenhaus: Etwa 90 bis 95 Prozent aller Krankenhausbehandlungen verlaufen ohne Zwischenfälle. Bei fünf bis zehn Prozent (ein bis zwei Millionen Patienten) pro Jahr treten jedoch „unerwünschte Ereignisse“ auf – von Drückgeschwüren über Fehldiagnosen bis hin zu schweren Infektionen. Vermeidbar wären bis zu 800.000 dieser unerwünschten Ereignisse, dazu gehören auch Todesfälle.
Ein Grund für die Defizite: Patientensicherheit wird immer noch oft fälschlicherweise als Kostenfaktor gesehen. Tatsächlich ist sie Erfolgsfaktor. Das vom Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) geförderte APS-Weißbuch Patientensicherheit zeigt: Isolierte Maßnahmen allein reichen nicht aus, um die Patientensicherheit nachhaltig zu verbessern. Sie muss alle Entscheidungen und Strukturen im Gesundheitswesen durchdringen. Dazu sind konkrete Schritte erforderlich, für die APS und vdek sieben Forderungen entwickelt haben.
- Verantwortliche für Patientensicherheit in allen Organisationen des Gesundheitswesens einsetzen
Die stetige Verbesserung der Patientensicherheit und ihre Verankerung im täglichen Handeln ist ein wichtiger Bestandteil einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung. Dafür benötigen Kliniken, Pflegedienste, Arztpraxen, Medizinische Versorgungszentren (MVZ) etc. einen Verantwortlichen, der die erforderlichen Veränderungen anstößt, durchsetzt, koordiniert und dauerhaft begleitet. Wir brauchen daher verbindliche gesetzliche Regelungen, die alle Organisationen des Gesundheitswesens dazu verpflichten, Verantwortliche für Patientensicherheit einzusetzen. Die Verantwortung für die Patientensicherheit muss wegen ihrer hohen Relevanz bei der Führungsebene angesiedelt sein. - Hygiene in Krankenhäusern weiter verbessern
Ein Anwendungsbeispiel für das im Weißbuch entwickelte Konzept der „komplexen Mehrfachintervention“, also die Kombination verschiedenster Maßnahmen, ist die Verbesserung der Hygiene und Infektionsprävention. Jährlich erkranken in Deutschland über 400.000 Patienten an einer Krankenhausinfektion, davon etwa 30.000 an multiresistenten Erregern (MRE). Ein Drittel der Infektionen ist in erster Linie auf Hygienemängel zurückzuführen, wäre also grundsätzlich vermeidbar. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass die bestehenden Maßnahmen zur Verbesserung der Krankenhaushygiene ausgebaut und ergänzt werden müssen. So fehlt bislang eine verbindliche bundeseinheitliche Hygiene-Richtlinie. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) muss gesetzlich ermächtigt und verpflichtet werden, in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut (RKI) eine solche Hygiene-Richtlinie mit verbindlichen Mindestanforderungen an die Struktur- und Prozessqualität zu entwickeln. Ein weiterer Baustein wäre, wenn das RKI seine Empfehlungen zum Screening von MRE-Risikopatienten auf Infektionen sowie zu Isolationsmaßnahmen zu klaren Vorgaben weiterentwickelt. Informationen darüber, wie Patienten und Angehörige zur Infektionsprävention und insbesondere zur Erkennung von lebensbedrohlichen Blutstrominfektionen (Sepsis) beitragen können, sollte die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zu einem Schwerpunktthema ihrer Aufklärungs- und Informationsarbeit machen. - Teilnahme an Fehlermeldesystemen muss verpflichtend werden
Mithilfe von Fehlermeldesystemen („Critical Incident Reporting Systems“, CIRS) werden an den Kliniken in Deutschland unerwünschte Ereignisse strukturiert erfasst und ausgewertet. Dadurch können Wiederholungen von Fehlern vermieden und Qualitätsprobleme aufgedeckt werden. CIRS leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Patientensicherheit. Einrichtungsinterne Fehlermeldesysteme sind bereits heute für alle Kliniken verpflichtend. Um den größtmöglichen Nutzen für die Patientensicherheit zu erzielen, muss für die Krankenhäuser auch die Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Fehlermeldesystemen verpflichtend werden. (Bislang beteiligt sich weniger als ein Drittel der Krankenhäuser an diesen einrichtungsübergreifenden Systemen.) - Deutsches Implantateregister für alle Beteiligten verbindlich machen
Das von der Politik geplante Deutsche Implantateregister kann, wie schon das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD), einen wichtigen Beitrag für mehr Patientensicherheit leisten. Register können ihre positive Wirkung auf die Patientensicherheit, z. B. durch frühzeitige Erkenntnisse über Produktfehler, jedoch nur bei möglichst lückenloser Teilnahme vollständig entfalten. Der Gesetzgeber muss deshalb die Teilnahme an wichtigen Registern für alle Beteiligten verpflichtend regeln – für Hersteller, Kliniken und alle Krankenkassen, inklusive der privaten Krankenversicherung (PKV). Sämtliche Hochrisikomedizinprodukte, wie Herzklappen, Herzschrittmacher oder bestimmte Hörprothesen (Cochlea-Implantate) sollten erfasst werden. - Patientensicherheit zum Thema in der Aus- und Weiterbildung machen
Das Thema Patientensicherheit muss in der Aus- und Weiterbildung aller medizinischen Berufe stärker verankert werden. Das APS hat hierzu einen Lernzielkatalog entwickelt, der in der Ausbildung aller Medizinberufe prominent umgesetzt werden sollte. Er unterstützt darin, die jeweiligen Ausbildungsinhalte ständig gezielt weiterzuentwickeln. Auch Forschung und Lehre zum Thema müssen
intensiviert werden: Bislang existiert in Deutschland beispielsweise nur eine einzige Professur für Patientensicherheit.
Das Weißbuch macht deutlich: Patientensicherheit ist nicht mit einer Anstrengung abgearbeitet, sondern begleitet ein ganzes Berufsleben lang. Für alle medizinisch und pflegerisch Tätigen müssen deshalb regelmäßige Fortbildungen zu diesem Thema verpflichtend vorgeschrieben werden. Der Gesetzgeber ist gefordert, dafür den rechtlichen Rahmen zu schaffen. Die konkreten Ausbildungsinhalte müssen in den Aus- und Weiterbildungsordnungen der Ärzte- und Pflegekammern festgelegt werden. - Patienten und Angehörige als aktive Partner mit einbeziehen
Gut informierte Patienten und Angehörige können einen maßgeblichen Beitrag für mehr Patientensicherheit leisten. Patienten sind oft die Einzigen, die den gesamten Behandlungsprozess kennen. Deshalb müssen sie (bzw. ihre Angehörigen) systematisch über anstehende Behandlungen und mögliche Behandlungsalternativen aufgeklärt werden. Beim Erstkontakt mit einem niedergelassenen Arzt oder einer Versorgungseinrichtung müssen Informationen über bereits erfolgte Therapien und eingenommene Medikamente einbezogen werden: entweder aus dem Gespräch mit den Patienten oder aus elektronisch verfügbaren Anamnesedaten. Aber auch im Verlauf und bei Abschluss von Behandlungen muss ein intensiver Austausch mit Patienten und ggf. Angehörigen erfolgen, mit dem Ziel, durch Unterstützung der Selbstfürsorgefähigkeiten die Patientensicherheit nachhaltig zu verbessern. Der GBA ist gefordert, Richtlinien zu verabschieden, die die umfassende Aufklärung von Patienten – einschließlich der Erfassung ihrer Vorerfahrung in der Behandlung – verbindlich festlegen. - Regelmäßige Patienten- und Angehörigenbefragungen durchführen
Befragungen von Patienten und Angehörigen sind ein weiteres Mittel, um direkt Erfahrungen aus Sicht der Versorgten zu erfassen und so die Patientensicherheit vor allem mit Blick auf gute Aufklärung und Vermeidung von Überversorgung zu erhöhen. Fragebögen wie sie das Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG) derzeit für Patienten mit Herzkatheter/Stent, schizotype Störungen sowie Nierenersatztherapie erarbeitet, müssen für weitere Erkrankungen und Behandlungen entwickelt und verbindlich eingesetzt werden. Die Ergebnisse müssen öffentlich dargestellt werden (Public Reporting).
Quelle: gemeinsame Pressemitteilung von Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V. (APS), Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) und Prof. Dr. Matthias Schrappe
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Technik
Darauf ist zu achten: Sicher mit dem Insulinpen umgehen

3 Minuten
- Bewegung
Faschingszeit: Gute Vorsätze – mit kurzer Pause
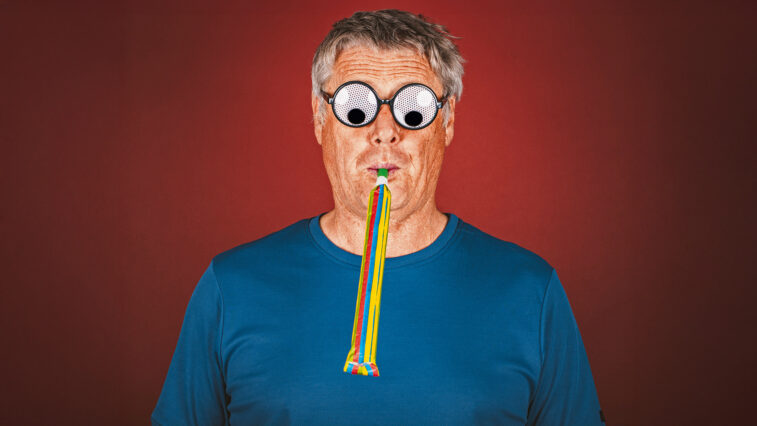
2 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 8 Stunden, 28 Minuten
Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!
-
wolfgang65 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 1 Tag, 4 Stunden
Liebe Leute, ich habe zwei neue Erfahrungen mach dürfen, die Ursächliche nicht so schön, woraus die 2. Erfahrung (notwendig gut) resultiert!
Ich bin kein Liebhaber von Zahnärzten und meine dort geführte Gesundheitsakte ist mit einem riesigen “A” für Angspatient gezeichnet. Ende letzten Jahres ist mir beim letzten verbleibenden Weisheitszahn (nie Schmerzen gemacht) größeres Teil abgebrochen, ZA meint, da geht er nicht bei, weil Zahn quer liegt, allso OP, und danach könnte man sich über Zahnersatz unterhalten … ich natürlich in Schockstarre gefallen, – gleich am selben Tag bei OP-Zahnarzt Termin gemacht, vor Weihnachten nix mehr möglich, gleich Anfang Januar Termin bekommen, Röntgenbild lag dem Chirugen bereits vor. Vieles wurde besprochen, auch der Zahnersatz, wobei der Chirug gleich meinte, dass ausser WZ wohl 3 weitere Zähne raus müssten. Schock nr. 2! Ich wollte mir aber noch 2Meinung einholen und fand Dank guten Rat von Bekannten, einen anderen Zahnarzt, dem ich mein Leid und Angst ausführlich schildern konnte und der auch zum erstenmal die Diabetes in Spiel brachte … kurz um ein bisher bestes aufklärendes Gespräch, wie weit Diabetes auch auf die Zahne und Zahnfleisch gehen kann. Bei mir Fazit Paradontites. (die 1. unschöne Erfahrung). Der Weisheits- und daneben liegende Zahn sind inzwischen raus, – war super gute und schmerzfreie OP, danach keinerlei Schmerzen, durfte allerdings auch Antibiotika nehmen. Die 2. Erfahrung: ich konnte meine Insulindosies halbieren, – bei 10 Tg. Antbiotika, und nun 15 ohne Medizin noch anhaltend niedrige Insulinmenge, mit steigender festen Nahrungsaufnahme.
Heute bei Diabetologen bestätigt, das Diabetiker besonders auf Ihre Zähne und Zahlfleich achten sollten. Da frage ich mich warum der Zahnarzt da nicht im Vorsorgekatalog von DMP aufgenommen ist.
LG Wolfgang
-
laila postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 1 Tag, 23 Stunden
Hallo ihr Lieben….Mein Name ist Laila…Ich bin neu hier…Ich wurde seit 2017 mit Diabetes 2 diagnostiziert.Da bekam ich den Diabetes durch laufen ohne Medies in den Griff.Das ging so bis Januar 2025.Ich weiss heute nochicht warum…aber ich hatte 2024 den Diabetes total ignoriert und fröhlich darauf losgegessen.Mitte 2025 ging ich Sport machen und gehen nach dem Essen.Und nahm immer megr ab.Htte einen Hb1C Wert von 8…Da ich abnahm, dachte ich, das der Wert besser ist…Bis Januar 2025…Da hatte ich einen HbA1C Wert von 14,8…Also Krankenhaus und Humalog 100 zu den Malzeiten spritzen…Und Toujeo 6 EI am Morgen…Irgendwann merkte ich, das mich kein Krankenhaus einstellen konnte.Die Insulineinheiten wurden immer weniger.Konnte kein Korrekturspritzen megr vornehmen.Zum Schluss gin ich nach 5 Mon. mit 2 Insulineinheiten in den Hypo…Lange Rede …kurzer Sinn.Ich ging dann auf Metformin…Also Siofor 500…Ich war bei vielen Diabethologen….Die haben mich als Typ 1 behandelt.Mit Metformin ging es mir besser.Meine letzte Diaethologin möchte, das ich wieder spritze.Ich komme mit ihr garnicht zurecht.Mein HbA1C liegt jetztbei 6,5…Mein Problem ist mein Gewicht.Ich wiege ungefähr 48 Kilo bei 160 m…Ich bräuchte dringend Austausch…Habe so viele Fragen…Bin auch psychisch total am Ende. Achso…Ja ich habe seit 1991 eine chronisch kalfizierende Pankreatitis…Und eine exokrine Pankreasinsuffizienz…Also daurch den Diabetes 3c.Wer möchte sich gerne mit mir austauschen?An Michael Bender:” Ich habe Deine Geschichte gelesen . Würde mich auch gerne mit Dir austauschen, da Du ja auch eine längere Zeit Metformin eingenommen hast.” Ich bin für jeden, mit dem ich mich hier austauschen kann, sehr dankbar. dankbar..Bitte meldet Euch…!!!
-
suzana antwortete vor 1 Tag, 21 Stunden
Hallo Leila, ich bin Suzana und auch in dieser Gruppe. Meine Geschichte kannst du etwas weiter unten lesen.
Es ist sicher schwer aus der Ferne Ratschläge zugeben, dennoch: ich habe mich lange gegen Insulinspritzen gewehrt aber dann eingesehen, dass es besser ist. Wenn die Pankreas nicht mehr genug produziert ist es mit Medikamenten nicht zu machen. Als ich nach langer Zeit Metformin abgesetzt habe, habe ich erst gemerkt, welche Nebenwirkungen ich damit hatte.
Ja auch ich muss aufpassen nicht in den unterzucker zu kommen bei Sport und Bewegung aber damit habe ich mich inzwischen arrangiert. Traubensaft ist mein bester Freund.
Ganz wichtig ist aber ein DiabetologIn wo du dich gut aufgehoben fühlst und die Fragen zwischendurch beantwortet.
Weiterhin viel Kraft und gute Wegbegleiter! -
laila antwortete vor 1 Tag, 18 Stunden
@suzana: Ich danke Dir für die Nachricht.Könnten wir uns weiterhin austauschen?Es wäre so wichtig für mich.Vielleicht auch privat? Gebe mir bitte Bescheid…Ich kenne mich hier leider nicht so gut aus…Wäre echt super…😊
-
wolfgang65 antwortete vor 1 Tag, 4 Stunden
Hallo Leila, auch von mir ein herzliches willkommen. Auch meine Geschichte liest du im weiteren Verlauf.
Zur “chronisch kalfizierende Pankreatitis” kann ich nix sagen, da ist immer das Gespräch mit dem Arzt/Diabetologen vorzuziehen, wie in allen Gesundheitsfragen. Was sagen Ärzte dazu, auch wg. der NICHTzunahme an Gewicht. Wenn ich mit einem Arzt nicht kann, oder dieser mir nicht ausreichende Infos gibt, schaue ich mich nach einem anderen Arzt/Diabetologen um, das ist Dein Recht, es geht um Deine Gesundheit!
Sollte mit der Nichtzunahme noch mehr dahinter Stecken, vielleicht
auch mal einen Psychologen in Deine Überlegung ziehen. Oder eine auf dich zugeschnittene Diabetes Schulung o.Ä., auch hier sollte Dich ein guter Diabetologe aufklären können.Soweit was mir im Moment einfällt. Lass es Dir gut gehen.
Gruss Wolfgang
-
michatype3 antwortete vor 1 Tag, 4 Stunden
Hey Laila, du kannst mir gerne hier im Typ 3c Bereich oder via PN schreiben. Ich bin gerade zwar etwas gesundheitlich angeschlagen, versuche aber, so gut es geht zu antworten.
-