- Eltern und Kind
Wie Jugendliche den Arztwechsel meistern
5 Minuten

Der Wechsel vom Kinder-Diabetesteam hin zum Erwachsenendiabetologen ist für Jugendliche und Eltern spannend, manchmal auch spannungsreich. Dieser Schritt bedeutet für junge Menschen, selbst mehr Verantwortung zu übernehmen, während die Eltern sich nach und nach zurückziehen sollten. Wie kann dieser Prozess, Transition genannt, gelingen? Dr. Gundula Ernst (Entwicklerin der Transitions-Seite between-kompas.de) schildert mögliche Probleme und Lösungen.
Leon ist gerade 17 Jahre alt geworden und hat Diabetes. Seit der Diagnosestellung vor elf Jahren besucht er mehrmals pro Jahr seine Diabetesambulanz in der Kinderklinik. Er kennt das Behandlungsteam mittlerweile gut und fühlt sich sehr wohl dort. Neulich sagte sein Diabetologe, er würde ihm gerne einen Kollegen empfehlen, der eine Diabetologische Schwerpunktpraxis für Erwachsene hat.
Leon ist von der Idee, den Arzt zu wechseln, nicht begeistert. Er hat gehört, dass die Erwachsenenärzte sich nur wenig Zeit für ihre Patienten nehmen. Außerdem fühlt er sich unwohl, wenn er an das Wartezimmer mit den vielen alten und kranken Menschen denkt. Seinen Eltern geht es ähnlich. Sie befürchten, dass Leon dort nicht so gut betreut wird wie in der Kinderklinik.
So geht es vielen …
So wie Leon und seinen Eltern geht es vielen Familien mit einem chronisch kranken Kind. Der Abschied von der vertrauten Kinderarztpraxis ist mit vielen Sorgen und Ängsten verbunden.
Dennoch ist der Arztwechsel in den meisten Fällen unvermeidlich. In der Regel dürfen Kinder- und Jugendärzte ihre Patienten nur bis zum 18. Geburtstag betreuen. Danach gelten sie vom Gesetz her als erwachsen, so dass die Erwachsenenmedizin zuständig ist. Dieser Arztwechsel wird Transition genannt. Ausnahmeregelungen gibt es bei einigen Erkrankungen oder in einigen Regionen, wenn keine qualifizierten Spezialisten zur Verfügung stehen.
Was ändert sich durch den Wechsel?
Aber nicht nur der betreuende Arzt ändert sich: Die Atmosphäre im Behandlungs- und Wartezimmer ist weniger familiär. Persönliche und familiäre Themen werden seltener angesprochen. Eine größere Selbständigkeit und Zuverlässigkeit im Umgang mit der Erkrankung werden vorausgesetzt, und es wird erwartet, dass der Patient selbst sagt, was für ihn wichtig ist. Der junge Patient wird verstärkt in Entscheidungen über weitere Behandlungsschritte einbezogen. Und: Die Eltern haben nun weniger Einblick in die Therapie.
Risiko oder Chance?
Ob diese Veränderungen positiv oder negativ sind, muss jeder für sich bewerten. Für manche ist die Übernahme von Verantwortung vielleicht ein Risiko, weil sie vergessen, zum Arzt zu gehen oder sich neue Rezepte geben zu lassen. Sie fühlen sich überfordert und allein gelassen. Für andere ist es eine Chance, weil sie nun eigene Entscheidungen treffen können und die größere Anonymität schätzen. Der neue Arzt hat noch keine Bild des Patienten im Kopf, und der Jugendliche kann sich von seiner “gereiften”, erwachsenen Seite zeigen.
Dass sich der behandelnde Arzt ändert, bedeutet nicht, dass sich auch die Therapieprinzipien und die Anzahl der Arztbesuche ändern. Gerade in Zeiten des Umbruchs ist eine regelmäßige Überwachung notwendig. Es ist wichtig, dass diese nicht abreißt, denn sonst kann es zu ernsthaften Komplikationen und langfristigen Folgeschäden kommen.
Transition ist ein Prozess
Erwachsenwerden ist ein Prozess, der nicht mit dem 18. Lebensjahr beginnt oder aufhört. Ähnlich wie Eltern ihre Kinder mit zunehmendem Alter immer stärker in das Diabetesmanagement einbeziehen, macht es auch der Kinder- und Jugendarzt. Zwar kommt der Jugendliche meist gemeinsam mit einem Elternteil in die Praxis, ab dem 14. Lebensjahr sollte jedoch ein Teil der Untersuchungen und des Gespräches alleine mit dem Arzt stattfinden.
Der Jugendliche kann dadurch langsam in die neue Aufgabe hineinwachsen und übernimmt zunehmend Verantwortung für sich und seine Erkrankung. Das Gespräch unter vier Augen gibt dem Jugendlichen und dem Arzt auch die Chance, sensible Themen anzusprechen, die man ungern vor den Eltern thematisiert, z. B. Alkoholkonsum, Sexualität oder Therapiefrust.
Mit dem Heranwachsen der Kinder verändern sich auch für die Eltern die Aufgaben. Ihre Rolle wandelt sich vom verantwortlichen Versorger hin zum beratenden Coach. Statt das Gespräch zu gestalten und die Entscheidungen zu treffen, sollten sie sich im Hintergrund halten und ihr Kind auf Fragen antworten lassen. Dabei fällt es nicht immer leicht, die Kontrolle aus der Hand zu geben. Als Eltern hat man jahrelang dafür gesorgt, dass es dem Kind gut geht und die Therapie erfolgreich umgesetzt wird. Mit der Abgabe der Verantwortung steigt die Gefahr, dass sich die Werte verschlechtern.
Eltern sollten sich aber vor Augen führen, dass es für das Kind wichtig ist, diesen Teil seines Lebens in naher Zukunft eigenverantwortlich zu managen. Keine Angst, die Werte verbessern sich in der Regel bald wieder, und auch bei großen Kindern bleiben die Eltern noch lange der wichtigste Ansprechpartner bei Gesundheitsfragen!
Transition – wann und wie?
Manche Jugendliche wechseln schon mit 14 Jahren in die Erwachsenenmedizin, andere erst, wenn es wirklich sein muss. Wann der richtige Zeitpunkt zum Wechsel ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits muss man sich fragen, ob man sich in der kinderärztlichen Praxis noch wohlfühlt und ob man sich “reif” genug fühlt, um die neue Herausforderung anzunehmen. Andererseits muss man prüfen, ob es in der Nähe einen geeigneten Arzt gibt. Am besten bespricht man dieses Thema mit dem bisherigen Arzt, ebenso die Frage, wie der Wechsel vonstattengehen soll.
Modelle für die Transition
Es gibt verschiedene Modelle für die Transition. Häufig reicht eine einfache Überweisung mit einem ausführlichen schriftlichen Abschlussbericht. Manchmal gibt es Extra-Übergangssprechstunden vom Kinderarzt und dem neuen Arzt gemeinsam. Manche Jugendliche besuchen eine Zeit lang beide Ärzte parallel, d. h. nach dem ersten Termin beim neuen Arzt gehen sie noch einmal zu ihrem Kinder- und Jugendarzt und besprechen mit ihm die Erfahrungen.
Wieder andere nehmen an einem Transitionsworkshop oder einem strukturierten Fallmanagement wie beim Berliner Transitionsprogramm teil. Dabei betreut ein Fallmanager den Jugendlichen über zwei Jahre, erinnert ihn an Termine und stattet alle Beteiligten mit den notwendigen Unterlagen aus.
Bei der Suche nach einem geeigneten Diabetologen ist der bisherige Behandler bestimmt gerne behilflich. Er weiß, welche Kollegen es in der Region gibt und kann hilfreiche Tipps geben. Selbstverständlich kann man auch andere Betroffene und Selbsthilfevereinigungen nach ihren Erfahrungen fragen. Eine Übersicht über die niedergelassenen Diabetologen, Diabeteszentren und Kliniken findet man auch im Internet auf den Seiten der Deutschen Diabetes Gesellschaft, der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenkassen.
Bevor man auf die Suche geht, sollte man sich jedoch überlegen, was einem bei einem neuen Arzt wichtig ist (z. B. Wohnortnähe, Qualifikation, spezielle Ausstattung, Geschlecht).
- die Verantwortung für die Therapie schrittweise abgeben
- mit dem Jugendlichen die dafür notwendigen Fertigkeiten trainieren (eigenständiges Diabetesmanagement, Erkennen und Äußern eigener Bedürfnisse, selbstbewusstes Nachfragen etc.)
- ihr Kind bestärken und für Erfolge loben
- akzeptieren, dass der Jugendliche Aufgaben anders angeht und eigene Prioritäten setzt
- durch Zuhören und passende Fragen dem Kind bei der Entscheidungsfindung helfen
- dem Kind Rückhalt geben und signalisieren, dass es nicht allein ist
Und Leon? Zum ersten Termin beim neuen Arzt hat seine Mutter ihn begleitet. Hinterher ist er sehr erleichtert. Der “Neue” hat sich viel Zeit für ihn genommen und kannte seine Krankengeschichte schon aus dem Arztbrief. Das Verhältnis war zwar nicht so fröhlich und herzlich wie in der Kinderambulanz, aber Leon meint, dass sie miteinander zurechtkommen werden.
Fazit
Die Transition sollte vom Kinderdiabetologen gemeinsam mit dem Jugendlichen und seinen Eltern so geplant werden, dass ausreichend Zeit für die Vorbereitung bleibt. Die Zeit vor dem Arztwechsel sollte genutzt werden, um schrittweise die Selbständigkeit im Umgang mit der Erkrankung zu trainieren.
Der Jugendliche sollte sich gedanklich auf den Wechsel einstellen und sich überlegen: “Was ändert sich für mich, und was habe ich für Fragen dazu?” Im Gespräch mit dem Kinderdiabetologen können alle anfallenden Fragen besprochen werden, und es kann überlegt werden, ob weitere Beratungen oder Hilfen sinnvoll sind.
von Dipl.-Psych Dr. Gundula Ernst
Medizinische Psychologie
Medizinische Hochschule Hannover
E-Mail: ernst.gundula@mh-hannover.de
Internet:
Erschienen in: Diabetes-Eltern-Journal, 2016; 9 (3) Seite 14-16
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Bewegung
Faschingszeit: Gute Vorsätze – mit kurzer Pause
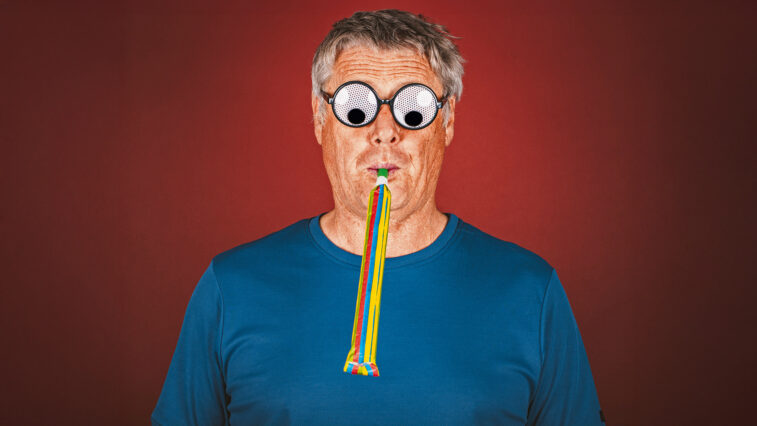
2 Minuten
- Behandlung
Mit Diabetes gut vorbereitet ins Krankenhaus: Was muss mit, was vorab geklärt werden?

5 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
wolfgang65 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 4 Stunden, 9 Minuten
Liebe Leute, ich habe zwei neue Erfahrungen mach dürfen, die Ursächliche nicht so schön, woraus die 2. Erfahrung (notwendig gut) resultiert!
Ich bin kein Liebhaber von Zahnärzten und meine dort geführte Gesundheitsakte ist mit einem riesigen “A” für Angspatient gezeichnet. Ende letzten Jahres ist mir beim letzten verbleibenden Weisheitszahn (nie Schmerzen gemacht) größeres Teil abgebrochen, ZA meint, da geht er nicht bei, weil Zahn quer liegt, allso OP, und danach könnte man sich über Zahnersatz unterhalten … ich natürlich in Schockstarre gefallen, – gleich am selben Tag bei OP-Zahnarzt Termin gemacht, vor Weihnachten nix mehr möglich, gleich Anfang Januar Termin bekommen, Röntgenbild lag dem Chirugen bereits vor. Vieles wurde besprochen, auch der Zahnersatz, wobei der Chirug gleich meinte, dass ausser WZ wohl 3 weitere Zähne raus müssten. Schock nr. 2! Ich wollte mir aber noch 2Meinung einholen und fand Dank guten Rat von Bekannten, einen anderen Zahnarzt, dem ich mein Leid und Angst ausführlich schildern konnte und der auch zum erstenmal die Diabetes in Spiel brachte … kurz um ein bisher bestes aufklärendes Gespräch, wie weit Diabetes auch auf die Zahne und Zahnfleisch gehen kann. Bei mir Fazit Paradontites. (die 1. unschöne Erfahrung). Der Weisheits- und daneben liegende Zahn sind inzwischen raus, – war super gute und schmerzfreie OP, danach keinerlei Schmerzen, durfte allerdings auch Antibiotika nehmen. Die 2. Erfahrung: ich konnte meine Insulindosies halbieren, – bei 10 Tg. Antbiotika, und nun 15 ohne Medizin noch anhaltend niedrige Insulinmenge, mit steigender festen Nahrungsaufnahme.
Heute bei Diabetologen bestätigt, das Diabetiker besonders auf Ihre Zähne und Zahlfleich achten sollten. Da frage ich mich warum der Zahnarzt da nicht im Vorsorgekatalog von DMP aufgenommen ist.
LG Wolfgang
-
laila postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 23 Stunden, 17 Minuten
Hallo ihr Lieben….Mein Name ist Laila…Ich bin neu hier…Ich wurde seit 2017 mit Diabetes 2 diagnostiziert.Da bekam ich den Diabetes durch laufen ohne Medies in den Griff.Das ging so bis Januar 2025.Ich weiss heute nochicht warum…aber ich hatte 2024 den Diabetes total ignoriert und fröhlich darauf losgegessen.Mitte 2025 ging ich Sport machen und gehen nach dem Essen.Und nahm immer megr ab.Htte einen Hb1C Wert von 8…Da ich abnahm, dachte ich, das der Wert besser ist…Bis Januar 2025…Da hatte ich einen HbA1C Wert von 14,8…Also Krankenhaus und Humalog 100 zu den Malzeiten spritzen…Und Toujeo 6 EI am Morgen…Irgendwann merkte ich, das mich kein Krankenhaus einstellen konnte.Die Insulineinheiten wurden immer weniger.Konnte kein Korrekturspritzen megr vornehmen.Zum Schluss gin ich nach 5 Mon. mit 2 Insulineinheiten in den Hypo…Lange Rede …kurzer Sinn.Ich ging dann auf Metformin…Also Siofor 500…Ich war bei vielen Diabethologen….Die haben mich als Typ 1 behandelt.Mit Metformin ging es mir besser.Meine letzte Diaethologin möchte, das ich wieder spritze.Ich komme mit ihr garnicht zurecht.Mein HbA1C liegt jetztbei 6,5…Mein Problem ist mein Gewicht.Ich wiege ungefähr 48 Kilo bei 160 m…Ich bräuchte dringend Austausch…Habe so viele Fragen…Bin auch psychisch total am Ende. Achso…Ja ich habe seit 1991 eine chronisch kalfizierende Pankreatitis…Und eine exokrine Pankreasinsuffizienz…Also daurch den Diabetes 3c.Wer möchte sich gerne mit mir austauschen?An Michael Bender:” Ich habe Deine Geschichte gelesen . Würde mich auch gerne mit Dir austauschen, da Du ja auch eine längere Zeit Metformin eingenommen hast.” Ich bin für jeden, mit dem ich mich hier austauschen kann, sehr dankbar. dankbar..Bitte meldet Euch…!!!
-
suzana antwortete vor 21 Stunden, 24 Minuten
Hallo Leila, ich bin Suzana und auch in dieser Gruppe. Meine Geschichte kannst du etwas weiter unten lesen.
Es ist sicher schwer aus der Ferne Ratschläge zugeben, dennoch: ich habe mich lange gegen Insulinspritzen gewehrt aber dann eingesehen, dass es besser ist. Wenn die Pankreas nicht mehr genug produziert ist es mit Medikamenten nicht zu machen. Als ich nach langer Zeit Metformin abgesetzt habe, habe ich erst gemerkt, welche Nebenwirkungen ich damit hatte.
Ja auch ich muss aufpassen nicht in den unterzucker zu kommen bei Sport und Bewegung aber damit habe ich mich inzwischen arrangiert. Traubensaft ist mein bester Freund.
Ganz wichtig ist aber ein DiabetologIn wo du dich gut aufgehoben fühlst und die Fragen zwischendurch beantwortet.
Weiterhin viel Kraft und gute Wegbegleiter! -
laila antwortete vor 18 Stunden, 47 Minuten
@suzana: Ich danke Dir für die Nachricht.Könnten wir uns weiterhin austauschen?Es wäre so wichtig für mich.Vielleicht auch privat? Gebe mir bitte Bescheid…Ich kenne mich hier leider nicht so gut aus…Wäre echt super…😊
-
wolfgang65 antwortete vor 4 Stunden, 35 Minuten
Hallo Leila, auch von mir ein herzliches willkommen. Auch meine Geschichte liest du im weiteren Verlauf.
Zur “chronisch kalfizierende Pankreatitis” kann ich nix sagen, da ist immer das Gespräch mit dem Arzt/Diabetologen vorzuziehen, wie in allen Gesundheitsfragen. Was sagen Ärzte dazu, auch wg. der NICHTzunahme an Gewicht. Wenn ich mit einem Arzt nicht kann, oder dieser mir nicht ausreichende Infos gibt, schaue ich mich nach einem anderen Arzt/Diabetologen um, das ist Dein Recht, es geht um Deine Gesundheit!
Sollte mit der Nichtzunahme noch mehr dahinter Stecken, vielleicht
auch mal einen Psychologen in Deine Überlegung ziehen. Oder eine auf dich zugeschnittene Diabetes Schulung o.Ä., auch hier sollte Dich ein guter Diabetologe aufklären können.Soweit was mir im Moment einfällt. Lass es Dir gut gehen.
Gruss Wolfgang
-
michatype3 antwortete vor 4 Stunden, 11 Minuten
Hey Laila, du kannst mir gerne hier im Typ 3c Bereich oder via PN schreiben. Ich bin gerade zwar etwas gesundheitlich angeschlagen, versuche aber, so gut es geht zu antworten.
-
-
vio1978 postete ein Update vor 2 Tagen, 9 Stunden
Habe wieder Freestyle Libre Sensor, weil ich damit besser zurecht kam als mit dem Dexcom G 6. ist es abzusehen, ob und wann Libre mit d. Omnipod-Pumpe kompatibel ist?🍀








