- Technik
CGM – Möglichkeiten, Anforderungen, Barrieren
5 Minuten
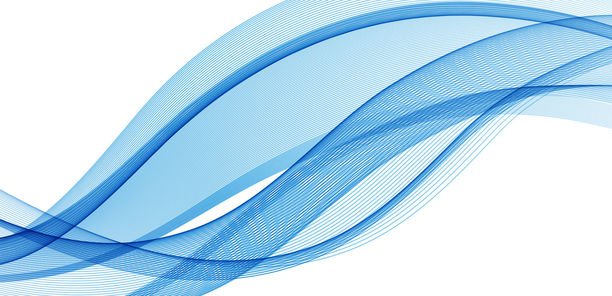
Prof. Thomas Kubiak (Mainz) befasst sich unter anderem damit, was kontinuierliche Glukosemessung (CGM) bei den Nutzern und ihrem Umfeld verändert. Er geht auch der Frage nach, für wen überhaupt CGM in Frage kommt. Wir sprachen mit ihm.
Diabetes-Journal (DJ): Sind in Ihren Augen Systeme zum kontinuierlichen Glukosemonitoring (CGM) grundsätzlich sinnvoll in der Diabetestherapie?
Prof. Kubiak: CGM-Systeme stellen prinzipiell eine wertvolle neue diagnostische Option zur Optimierung der Insulintherapie dar. Durch die unmittelbare Verfügbarkeit von Glukosemesswerten erhalten Patienten in Echtzeit Rückmeldung – dies kann, um nur ein Beispiel zu nennen, die frühe Erkennung von Schwankungen im Blutzucker aufgrund der Fehleinschätzung des Kohlenhydratgehalts von Mahlzeiten erleichtern.
Die Möglichkeit, individuelle Grenzen für Alarme bei niedrigen Glukosewerten durch das CGM zu setzen, wie auch die automatische Abschaltung von Insulinpumpen bei kombinierten Systemen im Fall von Unterzuckerungen können Patienten mit Hypoglykämie-Problemen Sicherheit geben. Bislang wenig beachtet sind die Lernmöglichkeiten für den Patienten: Die Dynamik der Glukosewerte über den Tag hinweg, die durch CGM abgebildet werden kann, bietet viele Chancen, den eigenen Glukosestoffwechsel besser zu verstehen und gemeinsam mit dem Behandler die Therapie zu optimieren.
Sicher profitieren aber nicht alle Patienten und Patientengruppen von CGM – ein Aspekt, dem in der Forschung bislang wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde.
DJ: Für wen kommt CGM denn eher in Frage – und für wen eher nicht?
Prof. Kubiak: Wer eine intensivierte Insulintherapieform mit Selbstanpassung der Insulindosis in ihrer Logik und Anwendung versteht und keine Probleme in der Handhabung der mittlerweile leicht zu handhabenden Technik hat, wird aller Voraussicht nach auch mit CGM keine Probleme haben. Wichtig sind vielmehr eine gewisse mentale Flexibilität und die Bereitschaft, sich auf Neues einzustellen.
Dies betrifft zuvorderst die Tatsache, damit umgehen zu lernen, dass CGM viele Ergebnisse liefert, die nicht auf Anhieb leicht zu verstehen sind – Trends sind wichtiger als Einzelwerte–, und dass CGM auf Gewebsglukosemessungen basiert, so dass bei rapiden Schwankungen (leichte) Verzögerungen gegenüber Blutzuckerwerten festzustellen sind. Menschen mit Typ-1-Diabetes sind derzeit sicher die Hauptzielgruppe bei der Nutzung von CGM – bei einer bestehenden Indikation wie einer Hypoglykämie-Wahrnehmungsproblematik ist eine sinnvolle Anwendung auch bei Menschen mit Typ-2-Diabetes zumindest denkbar.
DJ: Wird der Blutzuckerlangzeitwert (HbA1c)automatisch besser durch CGM-Nutzung, werden schwere Unterzuckerungen bei jedem CGM-Nutzer weniger als vorher?
Prof. Kubiak: Das ist sicherlich kein Automatismus und hängt in erster Linie davon ab, wie CGM in ein Gesamtbehandlungskonzept integriert ist und ob der Patient CGM für die Verbesserung seiner Stoffwechselkontrolle nutzt. Im Durchschnitt zeigen Studien durchaus eine Verbesserung des Langzeitzuckerwertes. Bei Unterzuckerungen ist die Befundlage weniger klar, aber auch hier gibt es Belege für eine Senkung der Anzahl von Unterzuckerungen. Interessant: Die klinische Erfahrung zeigt, dass gerade bei Menschen mit einer Hypoglykämie-Wahrnehmungsproblematik ein guter HbA1c-Wert bei gleichzeitiger weitgehender Vermeidung von Hypoglykämien durch CGM erreichbar ist.
DJ: Ist CGM ein interessantes Forschungsfeld auch über die Diabetologie hinaus – zum Beispiel in der Verhaltensmedizin?
Prof. Kubiak: Die CGM macht neue Einblicke in vielen Bereichen möglich und erlaubt es, Forschungsfragen, bei denen der Glukosestoffwechsel eine große Rolle spielt, neu zu beleuchten. In der Verhaltensmedizin eröffnet die CGM große Möglichkeiten auf dem Gebiet der Hypoglykämieforschung und stellt einen neuen, wichtigen methodischen Zugang dar, der etablierte Labormethoden ergänzt, um die Wahrnehmung von Unterzuckerungsanzeichen im Alltag besser zu verstehen. Wir in Mainz nutzen CGM in der Forschung auch zur Untersuchung des Einflusses von körperlicher Betätigung auf den Zuckerstoffwechsel bei Menschen, die unter einer Vorstufe des Typ-2-Diabetes leiden.
Kontakt: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, FB 02, Psychologisches Institut, Abteilung Gesundheitspsychologie, 55099 Mainz, E-Mail: kubiak@uni-mainz.de
DJ: Kann man denn schon vor Einsatz von CGM sagen, wer sein System eher häufig nutzen wird und wer eher nicht so häufig?
Prof. Kubiak: Studienergebnisse aus den USA legen nahe, dass Kinder und Jugendliche CGM mitunter eher unregelmäßig nutzen, aber auch hier waren die Unterschiede groß – und in dieser Altersgruppe, man denke an die Pubertät, ist es mitunter schwierig, eine optimale Diabetesselbstbehandlung konsequent umzusetzen. Insgesamt ist davon auszugehen, dass bei CGM eine Regel gilt, die auch auf andere neue Technologien außerhalb des Diabetesbereichs zutrifft: Neue Technologien werden genutzt, wenn sie im Alltag den Patienten wirklich etwas nützen, wenn sie konkrete Vorteile bei gegebenenfalls akzeptablem Zusatzaufwand bringen.
Eine große Rolle spielen neben den notwendigen Fertigkeiten und Kompetenzen, die CGM sinnvoll zu nutzen, auch psychosoziale Faktoren. Dieser Bereich ist leider viel zu wenig untersucht. Beispielsweise können der Gedanke, ein (weiteres) technisches Gerät mehr oder weniger dauerhaft am Körper zu tragen, oder das Gefühl, von Technik abhängig zu sein, wichtige Barrieren sein, die einer CGM-Nutzung entgegenwirken. Auch kann bei nicht entsprechender Schulung die Informationsfülle – die Glukosewerte sind ja ständig verfügbar – als Überforderung erlebt werden und Stress erzeugen.
Durch die sofortige und ständige Verfügbarkeit der Werte mag der Diabetes auch als präsenter erlebt werden. Mitunter kann ein Patient auch verleitet sein, unmittelbar auf kleine Glukoseschwankungen therapeutisch zu reagieren, was nicht hilfreich ist und eher zu einer instabilen Glukoseeinstellung führt. Eine erfolgreiche Nutzung von CGM erfordert spezifische Kompetenzen, die in einer Schulung vermittelt werden sollten. Patienten müssen in die Lage versetzt werden, die Informationen, die CGM und Blutzuckerselbstkontrolle liefern, in sinnvoller Weise in ihre Diabetestherapie zu integrieren und in zielgerichtetes Therapiehandeln zu übersetzen.
DJ: Studien zeigen, dass viele CGM-Nutzer das System nicht täglich, nicht häufig verwenden: Wieso ist das so – und welche Risiken oder Nachteile birgt das in sich?
Prof. Kubiak: Das Nutzungsverhalten unterscheidet sich zwischen Patienten in der Tat deutlich. Sicher bietet eine regelmäßige, nicht zwangsläufig tägliche Nutzung der CGM die besten Voraussetzungen, um den größten Nutzen daraus zu ziehen. So konnte auch gezeigt werden, dass die CGM die größte Wirkung bei Patienten hatte, die das System dauerhaft nutzten. Umgekehrt: Bei einer eher unregelmäßigen, sporadischen Nutzung des Systems ist der Erfolg der CGM z. B. in Hinblick auf eine Senkung des Langzeitzuckerwerts geringer. Allerdings gibt es auch Patienten, die die CGM nur in bestimmten Situationen gezielt nutzen, z. B. nur an Arbeitstagen, bei Sport oder zu Zeiten, in denen häufiger Unterzuckerungen auftreten.
DJ: Wie reagieren Freunde, Bekannte, Kollegen darauf, wenn ich als Betroffener auf mein CGM-System hinweise?
Prof. Kubiak: Im Regelfall mit Neugier. Häufig wird auch gefragt, ob das CGM-System einem denn jetzt die ganze Diabetesbehandlung automatisch abnimmt und z. B. eine Insulinpumpe steuert – was derzeit noch nicht zutrifft. Ebenso denken viele, CGM mache Blutzuckermessungen überflüssig, was nicht ganz stimmt, und wundern sich, dass der Diabetiker nach wie vor seinen Blutzucker misst. Recht oft wird ein CGM-System irrtümlicherweise aber einfach für ein neuartiges “gadget” gehalten – was in einer Zeit der zunehmenden Verbreitung tragbarer Technologie, sogenannter “wearables” vom Smartphone bis zur Smartwatch, nicht verwundert.
DJ: Wie wirkt sich CGM auf den Partner eines Typ-1-Diabetikers aus?
Prof. Kubiak: Ähnlich wie bei Eltern diabetischer Kinder kann eine CGM dem Partner oder der Partnerin eines Menschen mit Typ-1-Diabetes mehr Sicherheit geben – zu denken ist hier zuerst an Unterzuckerungen, vor allem während der Nacht. Allerdings können zumindest kurzfristig Themen in der Partnerschaft aktuell werden, wie eine erlebte stärkere Präsenz des Diabetes oder einfach der Umstand, noch ein technisches Gerät zu tragen. Diese können aber in der Regel leicht geklärt werden.
DJ: Nochmal zur Schulung: Welche Rolle spielt sie im Vorfeld eines CGM-Einsatzes, und wie sieht die Schulung idealerweise aus?
Prof. Kubiak: Eine entscheidende. CGM ist wie gesagt eine neue diagnostische Möglichkeit, die, wenn sie sinnvoll und erfolgreich sein soll, einer ganzen Reihe von Fertigkeiten und Kompetenzen bedarf. Strukturierte Schulungs- und Behandlungsprogramme, die sich gezielt mit der CGM in der Diabetestherapie befassen, sind leider noch Mangelware – international wie in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum wurde ein herstellerneutrales Schulungsprogramm von der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Technologie der Deutschen Diabetes Gesellschaft entwickelt (SPECTRUM), das diese Lücke schließen wird.
Als Patient lernt man, ein CGM-System sicher und erfolgreich anzuwenden: z. B. die Informationen des CGM-Geräts zu verstehen, die Alarmfunktionen optimal zu nutzen und aus den CGM-Daten die richtigen therapeutischen Schlüsse zu ziehen.
SPECTRUM zielt bei den Inhalten, der Sprache, der Herangehensweise jeweils punktgenau auf die Zielgruppen: Erwachsene, Eltern mit Kleinkindern und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes. Es kann genutzt werden für ICT und Pumpentherapie.
Interview: Günter Nuber
Kirchheim-Verlag, Kaiserstraße 41, 55116 Mainz,
Tel.: (0 61 31) 9 60 70 0, Fax: (0 61 31) 9 60 70 90,
E-Mail: redaktion@diabetes-journal.de
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2016; 65 (1) Seite 16-18
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Behandlung
Bericht vom t1day 2026: Technik, Menschen, Emotionen

5 Minuten
- Psyche
Menschen mit psychischen Erkrankungen erhalten häufig eine schlechtere Diabetes-Versorgung

2 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
lelolali postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 2 Tagen, 3 Stunden
Hallo, ich bin noch ganz neu hier. Ich war heute beim T1day und bin dadurch auf den DiabetesAnker aufmerksam geworden. Ich bin Ende 20 und komme aus Berlin und bin auf der Suche nach anderen Menschen mit Typ 1 Diabetes (ungefähr in meinem Alter) zum Austauschen und Quatschen. Vielleicht hat ja jemand Interesse 🙂
-
jasminj postete ein Update vor 2 Tagen, 11 Stunden
Hi,
Ich bin Jasmin und gerade auf dem t1day 🙂 hab seit 23 Jahren Diabetes, aktuell mit Ypsopump und G7. Bin entweder in Hamburg oder Berlin anzutreffen und freue mich auf Kontakte und Austausch!-
lelolali antwortete vor 2 Tagen, 4 Stunden
Hey Jasmin, ich war heute auch auf dem T1day, vielleicht hast du Lust auf Austausch 🙂
-
jasminj antwortete vor 2 Tagen, 3 Stunden
@lelolali: Ich würde mich über Austausch und Kontakte sehr freuen. Gerne hier oder anders online und ansonsten bin ich aktuell alle ein bis zwei Wochen in Berlin – also ggf. auch gerne persönlich?
Wie hat Dir der Tag gefallen? -
lelolali antwortete vor 2 Tagen, 2 Stunden
@jasminj: Ja sehr gerne! Ich kann dir hier leider keine private Nachricht schreiben (werde auf die Startseite weitergeleitet) , funktioniert dies bei dir? 🙂
-
jasminj antwortete vor 2 Tagen, 1 Stunde
@lelolali: funktioniert bei mir leider auch nicht. Ich wollte es mir morgen nochmal über die Webabsicht anschauen, vllt geht es da 🙂
-
gregor-hess antwortete vor 1 Tag, 7 Stunden
@jasminj & @lelolali: Leider funktionieren die DM aktuell tatsächlich nicht, sorry! Wir kümmern uns schnellstmöglich darum!
LG Gregor aus der Redaktion -
gregor-hess antwortete vor 17 Stunden, 32 Minuten
-
jasminj antwortete vor 16 Stunden, 22 Minuten
@gregor-hess: vielen lieben Dank! Hab es direkt ausprobiert und es sieht gut aus 🙂
-
-
galu postete ein Update vor 6 Tagen, 8 Stunden
hallo,
ich bin d«Deutsche und lebe seit ca.40jahren in Portugal… meine Tochter, deutsch portugiesin, nun 27 ist seit ihrem 11.Lebensjahr Typ1.
Nachdem ich, gleich nach der Diagnose, eine Selbsgthilfegruppe – die jungen Diabetiker der Algarve, gegruendet habe – finden wir nun so einige Beschraenkungen, was Selbsthilfe und relevante Info betrifft….meine Frage an die Gruppe:
Kann mir jemand , irgendwo in Deutschland eine gute Diabetes Kur oder Kuren mit Hauptgewicht auf Diabetes empfehlen?
Wir werden eh alles privat organsieren und bezahlen muessen – also sind eh nicht auf Krankenkassenangebote angewiesen (falls es diese ueberhaupt (wo?) geben sollte)
Irgendwo in Deutschland (vielleicht nicht zuweit weg von internationalen Flughaefen, da wir ja immer aus Portugal kommen muessen.
Hat vielleicht jemand eine Idee? vielen dank im Voraus-
connyhumboldt antwortete vor 6 Tagen, 6 Stunden
Hallo! Die beste Klinik für Diabetes ist in Bad Mergentheim! Ich hoffe Euch damit geholfen zu haben! Die Gesetzlichen Krankenkassen schicken die bei ihnen versicherten Diabetiker alle dahin! Privat geht aber auch? Liebe Grüße aus dem kalten Deutschland!
-










Hey, ich bin Lara und 23 Jahre alt. Ich komme zwar nicht aus Berlin, aber bin im Mai wieder dort. Freue mich trotzdem immer über Austausch, auch wenn es digital ist. Liebe Grüße
@laratyp1life: Hallo, über digitalen Austausch freue ich mich natürlich auch 🙂