- Technik
Hilfsmittel oder NUB? Das ist die Frage!
5 Minuten

Der Einsatz eines Systems zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM-System) kann eine wertvolle Therapieunterstützung sein. Integrierte Alarmfunktionen können die Anwender eines CGM-Systems über sich ankündigende Unterzuckerungen oder auch hyperglykämische Zustände mitunter relativ zuverlässig informieren, so dass rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Für die Patienten kann ein solches System daher entscheidend dazu beitragen, die Stoffwechseleinstellung stabil zu halten und somit die Therapie zu optimieren.
Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen, damit die Kosten für ein CGM-System von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. In diesem Beitrag informieren wir Sie über die aktuelle Rechtslage.
Mitglieder einer gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) haben Anspruch auf medizinisch notwendige Behandlungsleistungen sowie auf Versorgung mit den dafür erforderlichen Hilfsmitteln. Medizinisch nicht indizierte, unnötige Verordnungen sind allerdings unzulässig, Gleiches gilt für Behandlungsleistungen, die als "Luxusbehandlungen" über das Maß des Erforderlichen hinausgehen.
CGMS: Hilfsmittel oder NUB?
Seit einigen Jahren sind kontinuierliche Glukosemonitoringsysteme (CGMS) erhältlich, bei denen über einen Sensor, der ins Unterhautfettgewebe gelegt wird, der Glukosegehalt in der interstitiellen Gewebsflüssigkeit kontinuierlich ermittelt und an eine Empfangseinheit gesendet wird.
Der Einsatz von CGM-Systemen ist im Vergleich zur Messung des Blutzuckers kostenintensiver – und es ist noch nicht endgültig geklärt, ob sie zu Lasten der GKVen verordnungsfähig sind. Das hängt davon ab, ob CGMS lediglich als "Hilfsmittel" oder als "neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode" (NUB) eingesetzt werden.
Hilfsmittel leichter verordnungsfähig
Für die Verordnungsfähigkeit eines Hilfsmittels gelten gemäß § 139 SGB V nur niedrige Voraussetzungen: Der Hersteller muss die Erfüllung der Qualitätsanforderungen und im Zweifel den medizinischen Nutzen nachweisen und eine ausreichende Bedienanleitung mitliefern. Nur wenn das Produkt kein Medizinprodukt ist bzw. über kein CE-Zeichen verfügt, müssen zusätzlich noch die Funktionstauglichkeit und die Sicherheit nachgewiesen werden. Liegen diese Voraussetzungen vor, wird das Produkt ins Hilfsmittelverzeichnis der GKVen aufgenommen und kann verordnet werden.
NUB: strengere Kriterien
Anders sieht es aus bei Vorliegen einer neuen Untersuchungs- und Behandlungsmethode: Diese dürfen gemäß § 135 SGB V grundsätzlich nur erbracht werden, wenn der diagnostische und therapeutische Nutzen anerkannt ist, eine medizinische Notwendigkeit hierfür besteht und auch die Kriterien der Wirtschaftlichkeit erfüllt sind. Die Bewertung erfolgt nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse in der jeweiligen Therapierichtung, außerdem hat sie jeweils im Vergleich zu bereits zu Lasten der Krankenkassen erbrachten Methoden zu erfolgen.
Werden diese Kriterien nicht erfüllt, dürfen solche Leistungen gemäß § 135 Abs. 1 S.3 SGB V nicht (mehr) als vertragsärztliche Leistungen zu Lasten der GKVen erbracht werden.
G-BA: CGMS kein Hilfsmittel
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), der zuständig für die Frage ist, welche Leistungen der medizinischen Versorgung von den GKVen erstattet werden, hat zwischenzeitlich entschieden, dass es sich bei der kontinuierlichen Glukosemessung nicht um ein Hilfsmittel handele. Vielmehr sei es eine neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode (NUB), deren Wirksamkeit und Evidenz zunächst überprüft werden müsse; hierzu wurde das gesetzlich vorgeschriebene Methodenbewertungsverfahren eingeleitet.
Diese Entscheidung wurde von Patientenverbänden und aus der Ärzteschaft heftig kritisiert, obwohl die Annahme einer NUB nach Abwägung aller Argumente nicht abwegig erscheint, denn auch ein Hilfsmittel kann nicht isoliert vom zugrundeliegenden Behandlungskonzept betrachtet werden.
Argumente für NUB
Wenn von Herstellern damit geworben bzw. von der Ärzteschaft argumentiert wird, dass die kontinuierliche Glukosebestimmung gegenüber der punktuellen Blutzuckerselbstmessung einen besonderen "medizinisch-therapeutischen Vorteil" aufweise, erst hierdurch die "aktuelle individuelle Stoffwechselsituation eines Patienten in Einzelheiten erkennbar" werde, fällt es tatsächlich eher schwer, im diesbezüglichen Einsatz solcher Systeme kein neues Behandlungskonzept zu erkennen.
Kontinuierlich gelieferte Messwerte ermöglichen aus fachmedizinischer Sicht sogar "ein umfassendes Bild über die individuelle Stoffwechseleinstellung und Glukosevariabilität eines Patienten, welche ohne CGM nicht bekannt wären". Nach Einschätzung der Arbeitsgemeinschaft diabetologische Technologie (AGDT) der Deutschen Diabetes Gesellschaft stellen solche Systeme "eine erhebliche und nicht ersetzbare Erweiterung gegenüber den Möglichkeiten der herkömmlichen Blutzuckermessung (Glukosemessung)" dar. Spätestens hieraus ergibt sich, dass Selbstmessung und CGM durchaus differenziert zu betrachten sind.
Ziel nicht entscheidend
Wie mit der herkömmlichen Blutzuckermessung soll auch mittels CGM eine möglichst normnahe Stoffwechsellage erreicht werden. Für die Verordnungsfähigkeit kann es aber nicht allein darauf ankommen, welches Ziel mit einem Hilfsmittel verbunden ist. So wird aber mitunter argumentiert, gestützt auf eine Entscheidung des Sozialgerichts Detmold (Urteil vom 01.12.2012 – S 5 KR 325/09). Das vom Gesetzgeber grundsätzlich vorgesehene Nutzenbewertungsverfahren würde mit dieser Argumentation dann aber quasi ausgehebelt und nur noch in den seltensten Fällen Anwendung finden können.
Eine solche Betrachtung würde nämlich dazu führen, dass nahezu jedes neue Medikament oder Hilfsmittel nur noch dann als neue Untersuchungs- und Behandlungsmethode anzusehen wäre, wenn diesem im Vergleich zu herkömmlichen Methoden eine gänzlich andere Zweckbestimmung oder Zielsetzung zukäme. Ein Hersteller hätte es daher selbst in der Hand, allein durch geschickt definierte Zweckbestimmung seines Produkts die Verordnungsfähigkeit zu erreichen.
Im Fall eines CGM muss daher zusätzlich auch berücksichtigt werden, ob und inwieweit sich die gelieferten Ergebnisse oder Messwerte auf die Therapie auswirken und wie diese sich im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungen unterscheiden.
Schwere Folgen abwenden
Solange die Nutzen- und Methodenbewertung noch nicht abgeschlossen ist, wird eine Kostenübernahme entweder davon abhängen, ob das Gerät tatsächlich als Hilfsmittel eingesetzt wird und das CGMS wirklich medizinisch notwendig ist oder ob die mit dem CGMS verbundenen, neuen Therapiemöglichkeiten zwingend erforderlich sind, um schwere Folgen für den Patienten abzuwenden.
Keine Rolle spielt, dass bislang keine Aufnahme ins Verzeichnis der verordnungsfähigen Hilfsmittel erfolgt ist, denn dieses stellt nach Auffassung des Bundessozialgerichts (Urteil 03.08.2006 Az.: B3KR25/05R) lediglich eine unverbindliche Auslegungshilfe dar.
Zweckmäßig, wirtschaftlich
Andererseits gilt gemäß § 12 SGB V:
Für den Ausgang eines Verfahrens kann daher entscheidend sein, ob der Verordnungszweck des Hilfsmittels (vorrangig) eine Selbstnutzung des Patienten vorsieht oder ob die Messergebnisse noch ärztlich bewertet werden (müssen) (vgl. BSG, Urteil vom 12.08.2009, B 3 KR 10/07 R, mit weiteren Nachweisen; BSG, Urteil vom 22.04.2009, B 3 KR 11/07 R).
Kostenübernahme durch Gerichtsbeschluss
In der Zwischenzeit gab es bereits einige Gerichtsentscheidungen, welche Krankenkassen zur Kostenübernahme verurteilt haben (SG Berlin vom 17.08.12, S 210 KR 1384/12 ER; SG Altenburg, S 30 KR 3953/11 ER; ebenfalls SG Detmold vom 09.01.2012, S 3 KN 113/11 KR ER). Allen diesen Sachverhalten war aber gemeinsam, dass es sich um Ausnahmefälle handelte; der Einsatz eines CGMS erschien dort zwingend erforderlich, um schlimmere Folgen zu verhindern.
Plausibel Gründe darlegen
Beim Antrag auf Kostenübernahme eines CGMS ist daher plausibel darzulegen, warum dieses im Einzelfall erforderlich ist, insbesondere warum der damit vorgesehene Zweck nicht bereits durch eine höhere Frequenz von Selbstmessungen erreicht werden kann. Die Krankenkassen sind nämlich nur zur Übernahme von Leistungen verpflichtet, die "ausreichend" für eine Versorgung sind. Eine Optimalversorgung nach dem neuesten Stand der Technik kann jedoch grundsätzlich nicht beansprucht werden.
Zur Begründung könnte angeführt werden, dass es Patienten tagsüber zwar vielleicht möglich ist, in kurzen Intervallen eine Selbstmessung durchzuführen, ihnen nachts dagegen eine mehrfache Unterbrechung des Schlafs auf Dauer sicher nicht zuzumuten ist. Bei Patienten mit Hypoglykämiewahrnehmungsstörungen bietet sich an, vorrangig auf die mit einem CGMS verbundenen Alarmfunktionen abzustellen und den Einsatzzweck hierauf zu fokussieren.
Durch Alarme Präzisierung
Bei den meisten CGMS erfolgt eine unmittelbare Anzeige der Messwerte und der Glukosekurve auf einem Display, was dafür spricht, dass das Gerät vorrangig den Patienten selbst ermöglichen soll, ihr Glukoseprofil zu ermitteln und bei Hyper- oder Hypoglykämien alarmiert zu werden. In diesem Fall wäre das grundlegende medizinische Behandlungskonzept nicht betroffen, die Patienten könnten dieses aufgrund der kontinuierlich gelieferten Ergebnisse lediglich präziser und effizienter umsetzen.
Das Gerät wäre dann nur ein Hilfsmittel, welches offensichtlich kein neues Therapiekonzept mit sich bringt, und dürfte bei entsprechender Indikationslage daher verordnet werden. Derzeit abzuraten ist bei der Argumentation aber von einem Bezug auf die mit der kontinuierlichen Datenerhebung verbundenen Therapiemöglichkeiten – denn gerade der damit verbundene Nutzen wird ja derzeit vom G-BA geprüft und ist auch innerhalb der medizinischen Wissenschaft nicht gänzlich unumstritten.
Hypoglykämien mit Folgen
Zusätzlich zu den vorstehenden Erwägungen kann man auch anführen, dass Unterzuckerungen nicht nur ein erhebliches Risiko gravierender Folgen bergen, sondern – nicht zuletzt auch im Straßenverkehr – lebensbedrohliche Auswirkungen haben können. Mit Hilfe des CGMS können Patienten Unterzuckerungen rechtzeitig erkennen und weitere gravierende Gesundheitsschäden vermeiden.
Es dürfte daher naheliegend sein, dies als spürbare, positive Auswirkung auf den Krankheitsverlauf zu betrachten, so dass auch unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eine Kostenübernahme aus allgemeinen Gründen in Betracht kommt.
Schließlich wäre auch denkbar, das CGMS als Hilfsmittel zum Ausgleich einer Behinderung gemäß § 33 Abs. 1 3. Alt. SGB V anzusehen, denn der Verlust der Fähigkeit zur rechtzeitigen Wahrnehmung von Unterzuckerungen stellt eine (erhebliche) Behinderung dar, welche durch die Alarmfunktion eines CGMS weitgehend kompensiert werden kann.
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Ernährung
Community-Rezept: Vietnamesische Sommerrollen mit Gambas von Chrissi

3 Minuten
- Aus der Community
Kolumne „Fernweh“: Planänderung – wie unsere Madagaskar-Reise einem Putsch zum Opfer fiel

2 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
bloodychaos postete ein Update vor 2 Tagen, 11 Stunden
Hat noch jemand Probleme mit dem Dexcom G7? Nachdem ich letztes Jahr im Sommer über drei Monate massive Probleme mit dem G7 hatte bin ich zum G6 zurückgewechselt. Jetzt zum Jahreswechsel bzw. jetzt Ende Februar wollte ich dem G7 mal wieder eine Change geben. Ich war davon ausgegangen, dass die Produktionsprobleme inzwischen behoben sind. Aber spätestens am dritten Tag habe ich massive Abweichungen von 50 – 70 mg/dL. Setzstellenunabhängig. Meine aktuellen G7 wurden im Dezember 2025 produziert. Also sollten die bekannten Probleme längst behoben worden sein. Zuerst lief es die ersten Monate von 2025 mit dem G7 super, aber im Frühjahr 2025 fingen dann die Probleme an und seitdem läuft der G7 nicht mehr bei mir, obwohl alle sagen, dass die Probleme längst behoben seien und der Sensor so toll funktioniert. Ich habe echt Angst. Mir schlägt das sehr auf die Psyche. Zumal ich die TSlim nutze, die nur mit Dexcom kompatibel ist und selbst wenn ich zur Ypsopump wechsel ist da der Druck, dass es mit dem Libre3 funktionieren MUSS. Ich verstehe nicht, warum der G7 bei allen so super läuft, nur ich bin die Komische, bei der er nicht funktioniert.
-
thomas55 postete ein Update vor 6 Tagen, 23 Stunden
Hallo,
ich habe zur Zeit die Medtronic Minimed 670G mit Libre als Sensor. Ich überlege, auf die 780G als AID mit dem Simplera umzusteigen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Sensor? Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? In der Vergangenheit wurden Neukunden der 780G nicht mit dem Simplera beliefert sondern nur Kunden, die die 780G schon länger nutzen. Das hat sich nach Aussagen von Medtronic-Mitarbeitern beim T1day heute genau umgekehrt. Mein Doc hat das vestätigt. Für mich als neuer Bezieher der 780G gut, für die Bestandskunden schlecht.
Danke vorab und bleibt gesund (von unserem Typ 1 lassen wir uns das Leben dank Technik nicht vermiesen!)
Thomas55 -
sayuri postete ein Update vor 1 Woche
Hi, ich bin zum ersten Mal hier, um mich für meinen Freund mit Diabetes Typ 1 mit anderen auszutauschen zu können. Er versteht nicht alles auf Deutsch, daher schreibe ich hier. Etwa vor einem Jahr wurde ihm der Diabetes diagnostiziert und macht noch viele neue Erfahrungen, hat aber auch Schwierigkeiten, z.B. die Menge von Insulin besser abzuschätzen. Er überlegt sich, mal die Patch-Pad am Arm auszuprobieren. Kann jemand uns etwas über eingene Erfahrungen damit erzählen? Ich wäre sehr dankbar!🤗🙏
Liebe Grüße
Sayuri




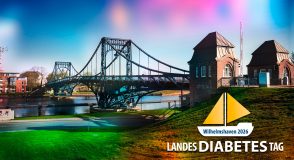


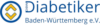


Kleine Ergänzung zum MeetUp von gestern.
Wenn ein “klassischer” Pumpenbetrieb ohne AID/Loop eine Option ist, dann tut sich eine breite Auswahl an CGM auf, die momentan auf dem deutschen Markt verfügbar sind:
Freestyle Libre 3 bzw. 3+
Dexcom G7
Dexcom G6 (noch)
Medtronic Guardian 4 (nur mit Medtronic-Pumpe)
Medtronic Simplera (nur mit Medtronic-Pumpe oder -Smartpen)
Eversense (implantiert für 1/2 Jahr, wird oft bei Pflasterallergien genutzt)
Accu-Chek Smartguide CGM
Medtrum Touchcare Nano CGM
Ich würde schätzen, dass die Reihenfolge ungefähr den Verbreitungsgrad widerspiegelt. Von Medtrum würde ich mir z.B. keinen grandiosen Kundenservice erhoffen. Aber wer weiß…?
Mag sein, dass ich etwas vergessen habe, aber die wichtigesten müssten dabei sein.