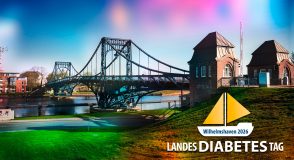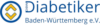- Ernährung
Lässt sich die Darmflora beeinflussen?
4 Minuten

Die Darmflora wird heute häufig auch Mikrobiom genannt. Mit Mikrobiom ist eigentlich die Masse aller Mikroorganismen im menschlichen Körper gemeint. Erkenntnisse darüber sind durch neue technische Möglichkeiten in den letzten Jahren gewachsen; viele offene Fragen könnten dadurch nun vielleicht beantwortet werden. Dr. Astrid Tombek kennt den aktuellen Stand der Forschung.
Präbiotika: Bestandteile von Lebensmitteln, die die Darmbakterien beeinflussen können
Probiotika: Bakterien, die gegessen werden und sich im Darm ansiedeln sollen
Im Darm von gesunden Menschen herrscht eine große Artenvielfalt (Biodiversität) – das haben Forscher herausgefunden. Und es gibt Erkenntnisse, dass die Darmflora bei gesunden Menschen aus anderen Keimen zusammengesetzt ist als bei Kranken. Nicht eindeutig klar ist, ob negative Keime mit einer geringen Artenvielfalt krank machen oder ob in einem kranken Organismus günstige Keime in einer hohen Artenvielfalt nicht überleben können.
Fakt ist, dass Menschen mit Übergewicht und Diabetes weniger günstige und mehr ungünstige Bakterien im Darm haben. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes findet sich dabei neben einer reduzierten Vielfalt insbesondere ein Rückgang von Bakterien, die kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure oder Propionsäure bilden. Kurzkettige Fettsäuren spielen eine große Rolle in der Regulation von Entzündungsprozessen.
Einfluss des Essens auf das Mikrobiom
Seit langer Zeit ist bekannt, dass eine ballaststoffreiche Lebensmittelauswahl sich positiv auf die Insulinresistenz (Unempfindlichkeit der Körperzellen für Insulin) bei Typ-2-Diabetes auswirkt. Die klassischen Hafer- oder Ballaststofftage werden heute deshalb wieder gern eingesetzt, um eine massive Insulinresistenz zu behandeln.
Viele Studien belegen den Vorteil von Ballaststoffen. Welche Wirkmechanismen dafür jedoch genau verantwortlich sind, ist zum Teil noch fraglich. Schon 1908 ging der Nobelpreis an Ilja Iljitsch Metschnikow, der zu diesem Thema forschte und schrieb: „… die lange Lebenserwartung einiger Ethnien ist die Folge einer Balance zwischen pathogenen und nonpathogenen Darmbakterien durch Konsumtion von fermentierter Milch mit darin lebenden Mikroorganismen.“ Dies war der Grundstein für die Erkenntnis, dass Darmbewohner im menschlichen Körper eine wichtige Rolle spielen.
Neuere Studien bestätigen, dass mit einer Gewichtsabnahme auch eine Verbesserung bei den positiven Bakterien einhergeht. Andere Studien befassen sich mit den Inhaltsstoffen der Ernährung und welchen Einfluss sie auf das Mikrobiom haben könnten. Lebensmittel, die die Darmflora beeinflussen können, werden häufig Präbiotika genannt.
Es sind im klassischen Sinn Lebensmittel oder Lebensmittelinhaltsstoffe, die sich günstig auf die Darmbewohner auswirken, da sie unverdaut in die tieferen Darmabschnitte gelangen und dort Bakterien als Nahrung dienen. Durch die Versorgung der Darmbakterien mit Präbiotika werden sowohl ihre Arten als auch ihre Anzahl beeinflusst.
Was sind Präbiotika? Und wie wirken sie?
Als besonders wirksame Präbiotika gelten Oligosaccharide wie Inulin, Frukto-Oligosaccharide (FOS) und Galakto-Oligosaccharide (GOS), die z. B. in Chicorée, Artischocken, Lauch, Knoblauch, Zwiebeln, Weizen, Roggen, Bananen, Topinambur, Hafer, Gerste, Sojabohnen, Mais und Schwarzwurzeln vorkommen. Auch Muttermilch hat einen hohen Anteil an GOS.
Durch Präbiotika wird die Konzentration an kurzkettigen Fettsäuren erhöht, zudem stimulieren sie das Wachstum von Bifidobakterien und Laktobazillen, die als günstige Keime gelten. Sie vermindern außerdem das Eindringen von krankmachenden Keimen in die Darmschleimhaut.
Folgende Ballaststoffe können als Präbiotika wirken: Flohsamenschalen, Leinsamen, Akazienfasern, Weizenkleie, resistente Stärke, Frukto- und Galakto-Oligosaccharide, Amylopektin, Citruspektin, Vollkornhirse, Buchweizen, Erdmandeln, Baobab (Affenbrotbaum). Dies erklärt auch, warum Ballaststoffe so wichtig in der Ernährung bei Typ-2-Diabetes sind und warum Ballaststofftage so effektiv sind bei einer Insulinresistenz.
Es gibt aber auch Nährstoffe, die negative Einflüsse auf das Mikrobiom haben. Dazu gehört Eiweiß in extremen Mengen, wie sie Kraftsportler oft verzehren. Aber sehr strikte Low-Carb-Diäten sowie eine Ernährung mit sehr hohem Fettanteil, raffinierten Kohlenhydraten und Stärke (also mit vielen Weißmehlprodukten, Süßigkeiten, süßen Getränken und eine Fülle an Fertiggerichten) sind ungünstig.
Die Wirkung von Probiotika auf das Mikrobiom
Bei Probiotika, also Bakterien, die gegessen werden und sich im Darm ansiedeln, ist die Studienlage sehr unterschiedlich. Probiotika können Lebensmitteln zugesetzt sein – ein Beispiel sind probiotische Joghurts – oder sie werden als Nahrungsergänzungspräparate angeboten. Meistens sind Synbiotika im Handel, die sowohl probiotische Keime als auch präbiotische Wirkstoffe enthalten.
Forscher wollen durch den Einsatz von Probiotika folgende positive Effekte gesehen haben: niedriger Body-Mass-Index (BMI), eine reduzierte Übergewichtsentwicklung und reduzierte Gewebeentzündung sowie eine verminderte Insulinresistenz. Ferner tragen Probiotika dazu bei, die physiologische Darmbarriere zu erhalten, und wirken Entzündungen entgegen.
Eine zusammenfassende Analyse vieler Studien kam zu dem Ergebnis, dass es keine Zusammenhänge mit Molkereiprodukten gab. Dennoch bewerten Experten Naturjoghurt als positiv, weil mit dem Konsum von Joghurt ein geringeres Risiko für Typ-2-Diabetes verbunden war. Menschen mit Typ-2-Diabetes zeigten in diesen Studien eine geringere Leberverfettung.
Allerdings scheinen Probiotika nicht bei allen Menschen gleich gut zu wirken: In der Gruppe der Resisters überlebten die Probiotika im Darm nicht, bei den Persisters hingegen schon. Die Forscher schließen daraus, dass nicht für jeden Menschen der Einsatz von Probiotika sinnvoll ist und dass sie im schlimmsten Fall auch bei dem einen oder anderen schädlich sein könnten.
Die Gene spielen eine zentrale Rolle
Eine genetische Veranlagung gibt vor, welche Arten von Bakterien im Darm vorherrschen und ob bzw. welche Arten durch die Nahrungs- oder Ergänzungsmittel überleben können. Eine ungünstige Ernährung und Erkrankungen wie Übergewicht und Typ-2-Diabetes beeinflussen das Darmmilieu negativ.
Eine ballaststoffreiche Ernährung dagegen wirkt sich positiv auf den Typ-2-Diabetes aus. Konkret heißt das: Sinnvoll ist eine betont pflanzenhaltige, ballaststoffreiche Lebensmittelauswahl. Auch ist es empfehlenswert, weniger Fleisch (besonders rotes Fleisch) zu essen, da sonst die Artenvielfalt gehemmt wird.
- Feste Nahrung? Nein, danke!
- Low Carb bei Diabetes: Ist das sinnvoll?
- Lässt sich die Darmflora beeinflussen?
- Leckere Ideen für Ihren Frühstücksteller
von Dr. Astrid Tombek
Dr. Astrid Tombek, Diabetes- und Ernährungsberatung,
Diabetes Zentrum Mergentheim,
Theodor-Klotzbücher-Straße 12, 97980 Bad Mergentheim,
Tel.: 0 79 31/5 94-1 61,
E-Mail: tombek@diabetes-zentrum.de
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2019; 68 (6) Seite 30-32
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Aus der Community
Viertjahrhundert Diabetes und Partnerschaft: 25 + 25 = ?

11 Minuten
- Ernährung
Tipps für die Fasten-Zeit: Mit Typ-1-Diabetes im Ramadan
3 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
cina_polada postete ein Update vor 2 Tagen, 12 Stunden
Hi, ich bin Julija und komme aus Frankfurt. Vor ein paar Wochen wurde bei mir Diabetes Typ 2 mit gerade mal 33 Jahren diagnostiziert.. Kämpfe im Moment noch sehr mit der Diagnose und würde mich über etwas Austausch sehr freuen 🙂
-
lauf-chris postete ein Update vor 2 Tagen, 14 Stunden
Ich habe jetzt seit ca 1 Jahr die YpsoPump. Bin gut damit zufrieden. Ist aber auch kein Selbstläufer!
-
marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 3 Tagen, 22 Stunden
Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!