- Ernährung
Pflanzenbetont essen: Vorteile veganer Ernährung nutzen und Risiken kennen
7 Minuten

Mischkost, vegetarisch, vegan: Wir Menschen haben die Auswahl. Viele Informationen zu veganer Ernährung gibt Ernährungsberater Claus Rothenbücher im Interview.
Im Interview: Claus Rothenbücher
Claus Rothenbücher ist Ernährungstherapeut (M.Sc.) und Psychologe (M.Sc.). Er führt eine Praxis zur Ernährungsberatung namens Nutrinia in Hofheim am Taunus. In seiner Beratungsarbeit verbindet er ernährungswissenschaftliche und psychologische Kompetenz, um individuelle, nachhaltige Ernährungsstrategien zu entwickeln. Gemeinsam mit seinen Klientinnen und Klienten entwickelt er einen individuellen Ernährungsplan, der nachhaltig funktioniert und auf die individuelle Lebenssituation und die individuellen Ziele abgestimmt ist.
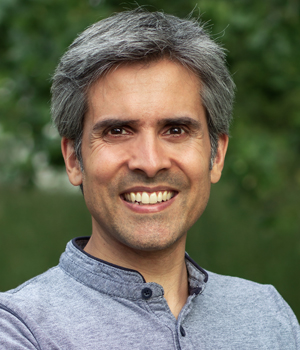
Dabei holt er die Menschen dort ab, wo sie gerade stehen, und begleitet sie auf ihrem Weg zu einer besseren Gesundheit und mehr Wohlbefinden.. Zudem engagiert er sich seit 2008 als Hochschuldozent und Seminarleiter in den Bereichen Ernährungstherapie, Gesundheits‑ und Ernährungspsychologie.
Diabetes-Anker (DA): Herr Rothenbücher, in den letzten Jahren konnte man immer mehr beobachten, dass sich Menschen vegan ernähren. Was ist vegane Ernährung und wie unterscheidet sie sich von vegetarischer Ernährung?
Claus Rothenbücher: Man geht immer von einer Mischkost aus. Das ist die Ernährungsform, die in den regulären Ernährungs-Empfehlungen, wie sie beispielsweise von der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung; Anm. d. Red.) herausgegeben werden, enthalten ist. Die vegetarische Ernährung schließt alles von einem toten Tier aus, also Fleisch, Wurst und Ähnliches. Es gibt „Vegetarier“, die Fisch mit reinnehmen als einzige Lebensmittelgruppe, die von einem toten Tier kommt, aber das sind die Pesketarier. Und wir haben die Flexitarier, die sich sehr pflanzenbetont ernähren, aber ab und zu doch das eine oder andere tierische Produkt, auch Fleisch, in die Ernährung nehmen.
Der klassische Vegetarier schließt neben den pflanzlichen Lebensmitteln auch Milch, Milchprodukte und Eier ein. Der Veganer schließt alle tierischen Lebensmittel aus. Das gilt zum Beispiel auch für Honig, denn die Honig-Produktion ist aus deren Sicht mit der Ausbeutung von Tieren verbunden. Ursprünglich ist der Veganismus eine Bewegung für die Rechte der Tiere und eine vegane Lebensweise steht im Prinzip im Einklang mit der veganen Philosophie. Eine vegane Ernährung ist eine Teilmenge davon: Man kann sich prinzipiell vegan ernähren, aber trotzdem beispielsweise tierische Produkte im Alltag nutzen, zum Beispiel Lederschuhe oder Ähnliches. Es ist am Ende eine ethische Entscheidung, eine vegetarische oder vegane Ernährung zu pflegen.
DA: Es gibt Personen, die sagen, Menschen seien „Allesfresser“ und bräuchten das auch …
Claus Rothenbücher: Ich denke, dass wir evolutionär im Durchschnitt – es gibt natürlich populationsspezifische Unterschiede – zumindest hier in Europa an eine Mischkost genetisch ganz gut angepasst sind. Heißt das, dass wir einer Mischkost nachgehen müssen? Das kann man sehr schwer beantworten, weil es keine eindeutigen Daten gibt. Wir sind das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, das Kochen als Möglichkeit der Nahrungszubereitung für sich entdeckt hat. Das hat dazu geführt, dass Kalorien leichter verfügbar wurden und wir mehr Kalorien zugeführt haben. Und es war mehr freie Glukose vorhanden, was die Hirn-Entwicklung auch günstig beeinflusst hat. Bestimmte Nährstoffe wurden durch das Garen auch bioverfügbarer. Und so hat sich auch unser Verdauungstrakt entsprechend entwickelt. Wir sind definitiv nicht karnivor, wie Katzen zum Beispiel oder Raubtiere, die Fleisch essen müssen.
Der Mensch hat eine gewisse Wahlmöglichkeit. Grundsätzlich haben wir Nährstoff-Bedarfe, essen aber Lebensmittel. Und mit diesen Lebensmitteln können wir, wenn wir sie geeignet kombinieren, unsere Nährstoff-Bedarfe und auch unsere Kalorien-Bedarfe decken. Jetzt ist die spannende Frage: Wie decke ich meine Nährstoff-Bedarfe? Bei den Mikronährstoffen – Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe – haben wir, zumindest in der Ernährungsberatung, häufiger das Problem, dass wir da aufholen müssen. Denn evolutionär haben wir über Hunderttausende Jahre immer auch tierische Lebensmittel gegessen. Mit diesen haben wir u. a. Stoffe, die der menschliche Körper auch selbst herstellen kann, in gewissen Mengen zugeführt. Lässt man tierische Lebensmittel weg, wäre es prinzipiell möglich, dass es zu Engpässen kommt. In den meisten Fällen funktioniert das aber, zumindest in den meisten Fällen im Erwachsenenalter. Ich gehe davon aus, dass die Ernährungs-Empfehlungen der meisten Fachgesellschaften gut den menschlichen Bedarf abdecken können.
Wenn wir den Ernährungskreis der DGE nehmen, haben wir zu etwa 75 Prozent pflanzliche Lebensmittel und 25 Prozent tierische Lebensmittel. Es ist eine pflanzenbetonte Ernährung, die ergänzt werden kann durch verschiedene tierische Lebensmittel, die natürlich, wie alle Lebensmittel, qualitativ hochwertig sein sollen. Was wir aktuell aus der Forschungsliteratur noch nicht erkennen können, ist, ob im Durchschnitt eine zu 100 Prozent vegane Ernährung besser ist als eine zum Beispiel zu 90 Prozent vegane Ernährung.
„Es gibt für die vegane Ernährung von der DGE ein Positionspapier, das würde ich den Lesern auch ans Herz legen. Dort sind alle Nährstoffe, die von der DGE als kritisch angesehen werden, aufgelistet. Und dort ist eine Tabelle zu finden, welche Quellen es für diese Nährstoffe gibt bzw. welche angereicherten Lebensmittel.“
DA: Welche Effekte bringt vegane Ernährung bei Menschen mit Prä-Typ-2-Diabetes oder Typ-2-Diabetes auf den Glukose-Stoffwechsel?
Claus Rothenbücher: Es kommt sehr darauf an, wie man die vegane Ernährung ausgestaltet. Das ist wie bei jeder Ernährungsform. Wenn ich eine vegane Ernährung zusammenstelle mit ausschließlich Bier, Chips und Pommes frites, ist das nicht so geschickt. Da würden wir auf längere Sicht Probleme bekommen. Wenn wir uns zum Beispiel nach der Gießener veganen Ernährungspyramide ernähren, die speziell dafür entwickelt wurde von Professor Dr. Claus Leitzmann und Kollegen aus Gießen, kann man eine vegane Ernährungsweise bedarfsdeckend gestalten. Bedarfsdeckend bezieht sich auf die klassischen Nährstoffe Kohlenhydrate, Fette, Proteine und Mikronährstoffe wie Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente. Da ist schon eine gewisse Supplementierung eingebaut. Wir reden da insbesondere über Vitamin B12, Vitamin D und die langkettigen Omega-3-Fettsäuren.
Ansonsten schaut man, dass es proteinbetont ist, mit Hülsenfrüchten, Soja-Produkten, Tofu, Tempeh, Seitan, Edamame-Bohnen, Nüssen und Ölsaaten, Vollkorngetreide, sodass man auch auf seine Protein-Mengen kommt. Der Gesundheitswert ist höher, wenn wir einen Fokus auf vollwertige Lebensmittel legen. Vollwertig bedeutet, vereinfacht gesprochen, dass von dem Lebensmittel in dem Zustand, wie es geerntet wurde, keine Nährstoffe rausgenommen und keine Extrakte genommen wurden und nichts Unvorteilhaftes in das Lebensmittel reingegeben wurde, sodass ich, wenn ich dieses Lebensmittel verzehre, das volle Nährstoff- und Ballaststoff-Spektrum dieses Lebensmittels habe.
Wenn ich das tue, habe ich automatisch einen Schwerpunkt auf Lebensmitteln, die eine eher geringere glykämische Last haben, die also den Blutzucker nicht so schnell ansteigen lassen. So kommen wir nicht in diese massiven Glukose-Gipfel und in der Folge Insulin-Gipfel. Wir würden damit auch Prävention betreiben, weil wir die Wahrscheinlichkeit für einen Typ-2-Diabetes reduzieren. Das zeigen auch große Studien wie die Adventist Health Study 2, wo wir über verschiedene Ernährungsformen hinweg sehen, dass deutlich seltener ein Typ-2-Diabetes auftritt, je pflanzenbetonter die Ernährung ist. Verglichen wurden Mischköstler, verschiedene Arten der Vegetarier und eben Veganer in einer vom Gesundheitsbewusstsein her recht homogenen Gruppe, sodass der Vergleich auch einigermaßen fair ist.
DA: Beim Typ-1-Diabetes ist Prävention durch die Ernährung nicht möglich, aber wären auch hier in der Therapie durch eine vegane Ernährung Vorteile erkennbar?
Claus Rothenbücher: Auch da ist die Forschungsliteratur nicht eindeutig. Ich würde sagen, ja, aufgrund des gleichen Prinzips, wenn wir eben nach Möglichkeit vermeiden, dass wir diese massiven Schwankungen im Blutzuckerspiegel und dementsprechend im Insulinspiegel haben. Er wird nicht ganz konstant bleiben, aber der Verlauf wird eher glatter sein, als dass er stark sprunghaft ist.
DA: Es gibt auch Pudding-Vegetarier oder -Veganer. Was ist darunter zu verstehen und welche Risiken bringt das mit sich?
Claus Rothenbücher: Das sind jene, die man auch als Junkfood-Veganer oder -Vegetarier bezeichnet. Damit bezeichnet man eine Personengruppe, die sich zwar vegan oder vegetarisch ernährt, aber vor allem hoch verarbeitete Lebensmittel isst: Pudding, Tiefkühlpizza, Burger, Pommes frites, Chips … Da haben wir natürlich ein höheres Risiko für Übergewicht und Typ-2-Diabetes.
DA: Wenn sich Menschen ausgewogen vegan ernähren, welche Risiken für die Gesundheit bestehen dann trotzdem?
Claus Rothenbücher: Es gibt für die vegane Ernährung von der DGE ein Positionspapier, das würde ich den Lesern auch ans Herz legen. Dort sind alle Nährstoffe, die von der DGE als kritisch angesehen werden, aufgelistet. Und dort ist eine Tabelle zu finden, welche Quellen es für diese Nährstoffe gibt bzw. welche angereicherten Lebensmittel. Im Einzelfall muss man auf die Packung des Produkts schauen, ob es angereichert ist mit Kalzium, Vitamin D, Vitamin B12 oder anderen kritischen Nährstoffen. Besonders kritische Lebensphasen sind Säuglings-, Kleinkind- und Kindesalter sowie Schwangerschaft und Stillzeit. In diesen Lebensphasen empfiehlt die DGE eine vegane Ernährung nicht.
„Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.“
DA: Sie haben eben auch Kalzium erwähnt. Nützt da zum Beispiel kalziumreiches Mineralwasser?
Claus Rothenbücher: Weil bei Veganern Milchprodukte als klassischer Kalzium-Lieferant wegfallen, gelten sie als anfälliger für einen Kalzium-Mangel als andere. Da gibt es niederschwellige Möglichkeiten. Wenn zum Beispiel eine pflanzliche Milch-Alternative genommen wird, empfehle ich, darauf zu achten, dass sie mit Kalzium angereichert ist. Im Normalfall ist das angepasst an den Kalzium-Gehalt der Kuhmilch, also 120 Milligramm auf 100 Milliliter. Dann könnte man gucken, was ich sonst noch an Kalzium-Quellen in der Ernährung habe, aber die sind bei veganer Ernährung oft knapp. Dann ist ein kalziumreiches Mineralwasser eine mögliche Strategie. Wenn man im Internet in eine Suchmaschine „kalziumreiches Mineralwasser“ eingibt, kriegt man Übersichtstabellen. Die empfohlene Tageszufuhr sind 1000 Milligramm pro Tag.
DA: Warum ist Kalzium auch besonders wichtig bei Diabetes?
Claus Rothenbücher: Kalzium ist unter anderem wichtig für die Knochen-Gesundheit. Es ist eine wichtige Variable in der Gleichung zum Thema Osteoporose-Prophylaxe. Es gibt Studien, die ein höheres Osteoporose-Risiko sehen bei Menschen mit Diabetes und auch ein höheres Risiko für Knochenbrüche. Andere Variablen in der Gleichung sind ausreichende körperliche Aktivität und zwar wirklich mit physischer Beanspruchung des Bewegungsapparats. Wenn wir über Kalzium reden, müssen wir eigentlich auch über eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung reden, weil Vitamin D die Kalzium-Aufnahme fördert.
Die klassische Vitamin-D-Quelle ist Fisch oder auch anderes, was aus dem Meer kommt. Das fällt in der veganen Ernährung aus. Ich muss also schauen, wo ich ansonsten Vitamin D finde. Da gibt es nicht besonders viel, aber es ist auch so, dass wir bei Weitem unseren Tagesbedarf an Vitamin D über die Ernährung allein nicht decken können, selbst unter Idealbedingungen. Die hauptsächliche Vitamin-D-Synthese im Körper passiert durch UVB-Strahlung und das in Deutschland oder Mitteleuropa auch nur etwa zwischen April und September, weil da die Intensität der Sonnen-Einstrahlung ausreichend wäre. In der anderen Jahreshälfte zehren wir von unseren Speichern. Das reicht aber in vielen Fällen nicht, sodass man auch hier zumindest nachdenken sollte über eine Supplementierung.
Gucken sollten wir noch auf Eisen. Oft geistert das Klischee umher, dass man bei einem Eisenmangel ein Steak essen sollte. Es ist richtig, dass Fleisch eine gute Eisenquelle ist, und das „tierische Eisen“ ist für den menschlichen Körper auch gut verwertbar. Auf der pflanzlichen Seite gibt es auch eisenreiche Lebensmittel, dunkelgrünes Blattgemüse zum Beispiel. Da braucht man allerdings gleichzeitig Substanzen, die die Aufnahme fördern, wie Vitamin-C-haltige Lebensmittel, wie eine rohe Paprika oder ein Obst zum Nachtisch. Auch Essigsäure und Äpfelsäure fördern die Eisenaufnahme. Und Hülsenfrüchte enthalten Ferritin, das Eisenspeicher-Protein, das ohne weitere aufnahmefördernde Stoffe direkt über die Darmschleimhaut aufgenommen wird. Wenn der Eisenspiegel oder auch das Ferritin im unteren Normbereich sind, ist es da, wo wir es haben wollen, dann sind wir gut versorgt.
DA: Das zeigt: Wer sich vegan ernährt, braucht ein gutes Wissen über die Ernährung. Wo findet man, neben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Informationen?
Claus Rothenbücher: Die Unabhängige Gesundheitsberatung, kurz: UGB, hat auch gute Informationen und auch das Forschungsinstitut für pflanzenbasierte Ernährung, kurz: IFPE. Und es gibt einiges an Literatur dazu.
DA: Vielen Dank für das Gespräch!
Buch-Tipps
- Claus Leitzmann, Markus Keller: Vegetarische und vegane Ernährung. UTB, Stuttgart, 2020. ISBN: 978-3-8252-5023-2. Preis: 35 Euro
- Michael Greger, Gene Stone: How Not To Die. Unimedica, Kandern, 2019. ISBN: 978-3-946566-12-0. Preis: 24,80 Euro
- David Flynn, Stephen Flynn: The Veg Box – 10 Gemüse, 100 Ideen. ISBN: 978-3-96584-312-7. ZS, München, 2023. Preis: 29,99 Euro
- Bianca Zapatka: Vegan Foodporn: 100 einfache und köstliche Rezepte. Riva, München, 2019. ISBN: 978-3-7423-1145-0. Preis: 26,00 Euro. Auch als E-Book verfügbar
Internet-Tipps
Interview: Dr. med. Katrin Kraatz
Erschienen in: Diabetes-Anker, 2025; 73 (8/9) Seite 38-40
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Soziales und Recht
Diabetes-Technologie im Praxis-Alltag: Der Fluch des Erfolgs

3 Minuten
- Aktuelles
Dubiose Online-Angebote: Diabetes-Verbände warnen vor gefährlichen Fake-Produkten und falschen Empfehlungen
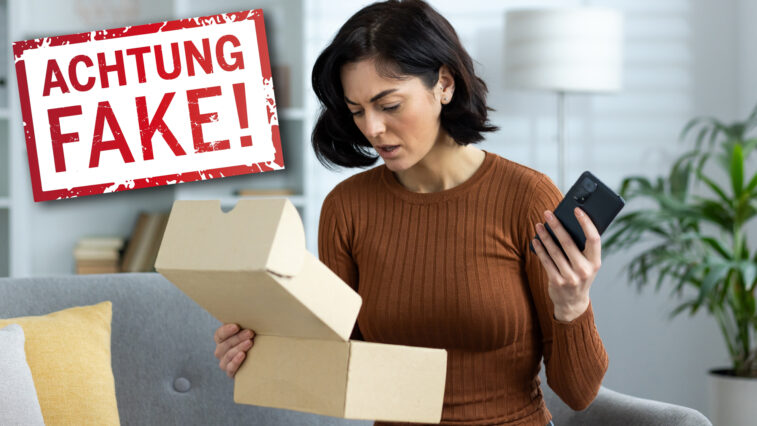
3 Minuten
Keine Kommentare
Über uns
Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Anzeige
Recor Medical
Das Verfahren der renalen Denervierung kann helfen, den Blutdruck effektiv zu senken.

