- Aus der Community
Mein Diabetes, meine Geschichte – Mila (30): „Du lebst nur kurz, warum dann nicht richtig?“
6 Minuten

Mila ist eine intelligente und selbstbewusste 30-Jährige. Ein kleiner Wirbelwind mit viel Humor. Man vermutet nicht, dass die angehende Erzieherin einen langen Kampf gegen den Diabetes und Depressionen hinter sich hat. Im April 2011 erhält sie die Diagnose. Sie studiert zu diesem Zeitpunkt Fitnessökonomie und arbeitet in einem Sportstudio. Bewegung, gesunde Ernährung und Leistung prägen ihren Alltag. Da passte der Diabetes so gar nicht hinein. Lange ignoriert sie die Erkrankung und begibt sich in Lebensgefahr. Es braucht einige Zeit, bis sie eine passende Therapieform findet und es bergauf geht. Mila möchte ihre Geschichte teilen, um die Bedeutung des Themas „Diabetes und Psyche“ zu zeigen und die Stigmatisierung zu durchbrechen.

Wann hast du deine Diagnose bekommen und wie war das für dich?
Das war Ostern 2011. Ich habe mit Freunden im Auto gemerkt, dass die Straßenschilder plötzlich verschwommen waren. Zuerst haben wir uns alle einen Spaß daraus gemacht und hatten den kleinen Wettbewerb, wann ich denn ein Schild lesen konnte. Am nächsten Morgen konnte ich aber nicht einmal mehr das S auf dem Salzstreuer erkennen. Da wurde meine Schwiegermutter hellhörig, stellte ein paar Fragen und sagte dann: „Du musst zum Notarzt, ich glaube, du hast Zucker!“
Ich habe noch einen Tag gewartet und bin dann erst ins Krankenhaus gegangen. Dort wurde ich ziemlich doof angeschaut, als ich meinte, dass ich Zucker haben könnte. Der Arzt sagte, ich sei mit meinen 23 Jahren zu alt dafür. Ein Wert von 600 mg/dl (33,3 mmol/l) überzeugte ihn dann doch.
Welche Gefühle hattest du im ersten Moment nach der Diagnose?
Ich wusste ja gar nicht, was Diabetes wirklich bedeutet. Ich hatte zwar gegoogelt, aber für mich war erstmal viel schlimmer, dass ich nicht mehr rauchen gehen durfte. Da bin ich dann eher der Rebell und habe mich durchgesetzt, um rausgehen zu können. Als es hieß, ich müsste über Nacht bleiben, war das für mich nochmal besonders schlimm. Es war das Krankenhaus, in dem mein Vater gestorben war. Daher habe ich mich am nächsten Tag auch sofort selber entlassen.
Wann hast du angefangen, dich mit der Diagnose auseinanderzusetzen?
Ich kann mich nicht so gut an diese Zeit erinnern. Ein Mitarbeiter aus dem Krankenhaus rief mich an und meinte, ich muss unbedingt einen Diabetologen aufsuchen. Ich bin dann auch zu einem Arzt gegangen. Dort bekam ich den nächsten Schock: Ich kam in die Praxis und am Empfang arbeitete ein Mädel aus meinem Dorf! Ich hatte Angst vor dem ganzen Tratsch. Zu diesem Diabetologen bin ich nie wieder hin.
Welchen Einfluss hatte der Diabetes auf dein Leben?
Ich habe damals Fitnessökonomie studiert und in einem Sportstudio gearbeitet. Ich habe versucht, einfach weiterzumachen. Im Kundenkontakt im Service war das aber schwierig. Viele Typ-2-Diabetiker kamen zu uns und ich dachte, die verurteilen mich. Das lag aber auch daran, dass ich nicht so richtig aussprechen konnte, welchen Typ ich habe, und immer versucht habe, das Thema zu vermeiden. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die über mich reden. Denn ich bin einfach nicht damit klargekommen. Auch nicht mit der Stigmatisierung, dass man selbst schuld sei, als Kind zu viel Süßes gegessen hat und und und… denn ich bin eine Naschkatze, wirklich! Immer noch! Damals habe ich mich aber tatsächlich gefragt, ob es davon kommt.
Wie war es mit den anderen Arbeitsbereichen zu vereinbaren, wenn vor allem körperliche Leistung gefragt war?
Als ich auf die Trainingsfläche wechseln sollte, habe ich gemerkt, dass das gar nicht mehr klappt. Leistung und Sport nach Terminplan war nicht mehr möglich. Ich fasste nach 6 Monaten den Entschluss wegzuziehen. Ich habe schnell ein anderes Fitnessstudio gefunden, in dem ich wesentlich weniger körperliche Belastung hatte. Sportlich habe ich nichts mehr gemacht. Ich habe mir selbst nichts mehr zugetraut und war meist nach 15 Minuten unterzuckert. Irgendwann war ich so weit, dass ich einfach gar kein Insulin mehr gespritzt habe, nur noch Basal. Niemand sollte sehen, wie ich unterzuckere. Das ging drei Monate so und dann hat mich alles wieder eingeholt.
Was ist dann passiert, nachdem du aufgehört hast, Insulin zu spritzen?
Ich dachte: „Du lebst nur kurz, warum dann nicht richtig?“ Am Tag der Diagnose sagte man mir, dass ich nur noch etwa 20 Jahre hätte. Dann habe ich auch richtig gelebt, gar keinen Bolus und nur vereinzelt Basal gespritzt und mir alles gegönnt, was ich wollte. Ich war so sehr in dieser Schleife drin, dass ich mich sogar darüber gefreut habe, dass ich alles essen konnte, keinen Sport treiben musste und dennoch nicht zunahm. Gleichzeitig wurde ich depressiv.

Wann kam der Wendepunkt?
Das Vorhaben, mein Leben in vollen Zügen zu genießen, habe ich bis zum November 2012 durchgezogen. Ich war bis auf 40 kg abgemagert, konnte keine zwei Treppenstufen mehr hochgehen. Irgendwann hat mich mein damaliger Freund und heutiger Ehemann abends mit Magenproblemen in die Notaufnahme gefahren. Ich kam gar nicht auf die Idee, dass die Schmerzen vom Diabetes kommen könnten. Die Ärzte leider auch nicht. Mit dem Tipp, viel zu trinken und zu schlafen, bin ich nach Hause geschickt worden. Am nächsten Morgen bin ich aber nicht mehr aufgewacht. Ich lag durch die Ketoazidose zwei Tage im Koma. Und mein erster Gedanke, als ich aufwachte, war: „Mein Gott, warum hast du das überlebt?“ – Erst die Reaktion meines Ehemannes öffnete mir die Augen. Er war geschockt, dass ich nicht mehr leben wollte.
Hast du dich dann in eine Therapie begeben, um deine Depression und Akzeptanzstörung behandeln zu lassen?
Noch nicht. Ich habe erst einmal wieder einen Diabetologen aufgesucht, angefangen, Insulin zu spritzen, und irgendwie versucht, die Situation zu retten. Es gab aber kein langfristiges Ziel. Ich habe erst einmal nur den Gedanken gehabt, dass ich für meinen Mann überlebe. Zusätzlich habe ich versucht, eine psychologische Behandlung anzufangen, aber es dauerte, bis ich den passenden Therapeuten und die passende Therapieform gefunden hatte. Ich habe mehrmals gewechselt, auch den Diabetologen. Irgendwann hatte ich eine gute Ärztin gefunden, die mich zum Glück in eine psychosomatische Klinik überwies. Dort hatte ich die Gelegenheit, endlich zur Ruhe zu kommen.
Wie ging es nach der Klinik weiter? Konntest du mit deinem Diabetes Frieden schließen?
Danach habe ich zum Glück eine gute Therapeutin gefunden, mit der ich Schritt für Schritt an der Akzeptanzstörung arbeiten konnte. Es ging nur um Diabetes, die Psyche und mich! Ich war 14 Monate lang krankgeschrieben und habe mich endlich mal um alles kümmern können. Ich war einmal in der Woche bei meiner Diabetologin und beschäftigte mich erstmals richtig mit der Erkrankung. Sozial habe ich mich komplett zurückgezogen und hatte nur Kontakt zu meinen Ärztinnen und meinem jetzigen Ehemann. Aber diese Menschen waren meine Stütze und das Netz, was mich auffing. In dieser Zeit habe ich endlich wieder angefangen, mich kreativ zu beschäftigen. Das entlastet mich psychisch sehr.
Glaubst du, dass dieser psychologische Aspekt wesentlich stärker in die Behandlung von Diabetikern mit einbezogen werden sollte?
Definitiv! Meine Psychologin hatte keine Ahnung von Diabetes, war aber interessiert und hat sich eingelesen, um mir zu helfen. Die Momente, in denen sie mir bei Gefühlen und Erlebnissen eine andere Brille aufgesetzt hat, um meine Perspektive zu ändern, waren entscheidend. Durch ihr angelesenes Wissen konnte sie mich gezielt fragen, ob gewisse Dinge nicht mit dem Diabetes zu erklären sind. Wie zum Beispiel Ängste oder Aggressionen bei Unterzuckerungen. Diese Therapie war für mich ein wichtiger Schritt hin zu einer besseren Akzeptanz.
Wie lange hat es gedauert, bis du den Diabetes akzeptiert hast?
Ich glaube, ich habe es bis heute nicht vollkommen akzeptiert. Aber ich arbeite kontinuierlich daran. Ich suche mir Menschen, Gleichgesinnte, andere Diabetiker. Die können einen verstehen und nachvollziehen, worüber man redet. Sie fühlen das, was auch ich fühle. Der Austausch und das Verständnis sind sehr wichtig für mich.
Was wünscht du dir für deine Zukunft mit Diabetes?
Heilung! Aber das realistischere Ziel ist, dass endlich die technischen Möglichkeiten genutzt werden können, ohne dass man sich halb strafbar macht und ein Technikgenie sein muss. Das Closed-Loop-System sollte für alle zugänglich sein. Und für mich persönlich wünsche ich mir, dass ich mich frei fühle!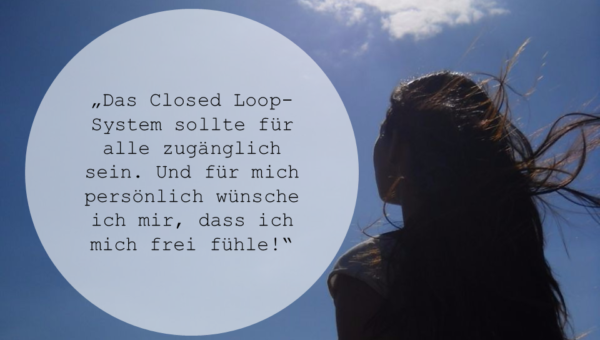
Diabetes hält dich nicht auf? Auch du hast eine bewegende Geschichte, die du mit anderen Diabetikern teilen möchtest? Dann schreibe eine Mail an: contact@diapolitan.com
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Ernährung
Zwei Tage intensive Haferkur reichen aus: Studie zeigt deutliche LDL-Cholesterin-Senkung

3 Minuten
- Behandlung
Bericht vom t1day 2026: Technik, Menschen, Emotionen

5 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
lelolali postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 5 Tagen, 21 Stunden
Hallo, ich bin noch ganz neu hier. Ich war heute beim T1day und bin dadurch auf den DiabetesAnker aufmerksam geworden. Ich bin Ende 20 und komme aus Berlin und bin auf der Suche nach anderen Menschen mit Typ 1 Diabetes (ungefähr in meinem Alter) zum Austauschen und Quatschen. Vielleicht hat ja jemand Interesse 🙂
-
jasminj postete ein Update vor 6 Tagen, 5 Stunden
Hi,
Ich bin Jasmin und gerade auf dem t1day 🙂 hab seit 23 Jahren Diabetes, aktuell mit Ypsopump und G7. Bin entweder in Hamburg oder Berlin anzutreffen und freue mich auf Kontakte und Austausch!-
lelolali antwortete vor 5 Tagen, 21 Stunden
Hey Jasmin, ich war heute auch auf dem T1day, vielleicht hast du Lust auf Austausch 🙂
-
jasminj antwortete vor 5 Tagen, 21 Stunden
@lelolali: Ich würde mich über Austausch und Kontakte sehr freuen. Gerne hier oder anders online und ansonsten bin ich aktuell alle ein bis zwei Wochen in Berlin – also ggf. auch gerne persönlich?
Wie hat Dir der Tag gefallen? -
lelolali antwortete vor 5 Tagen, 20 Stunden
@jasminj: Ja sehr gerne! Ich kann dir hier leider keine private Nachricht schreiben (werde auf die Startseite weitergeleitet) , funktioniert dies bei dir? 🙂
-
jasminj antwortete vor 5 Tagen, 19 Stunden
@lelolali: funktioniert bei mir leider auch nicht. Ich wollte es mir morgen nochmal über die Webabsicht anschauen, vllt geht es da 🙂
-
gregor-hess antwortete vor 5 Tagen, 1 Stunde
@jasminj & @lelolali: Leider funktionieren die DM aktuell tatsächlich nicht, sorry! Wir kümmern uns schnellstmöglich darum!
LG Gregor aus der Redaktion -
gregor-hess antwortete vor 4 Tagen, 10 Stunden
-
jasminj antwortete vor 4 Tagen, 9 Stunden
@gregor-hess: vielen lieben Dank! Hab es direkt ausprobiert und es sieht gut aus 🙂
-
-
galu postete ein Update vor 1 Woche, 3 Tagen
hallo,
ich bin d«Deutsche und lebe seit ca.40jahren in Portugal… meine Tochter, deutsch portugiesin, nun 27 ist seit ihrem 11.Lebensjahr Typ1.
Nachdem ich, gleich nach der Diagnose, eine Selbsgthilfegruppe – die jungen Diabetiker der Algarve, gegruendet habe – finden wir nun so einige Beschraenkungen, was Selbsthilfe und relevante Info betrifft….meine Frage an die Gruppe:
Kann mir jemand , irgendwo in Deutschland eine gute Diabetes Kur oder Kuren mit Hauptgewicht auf Diabetes empfehlen?
Wir werden eh alles privat organsieren und bezahlen muessen – also sind eh nicht auf Krankenkassenangebote angewiesen (falls es diese ueberhaupt (wo?) geben sollte)
Irgendwo in Deutschland (vielleicht nicht zuweit weg von internationalen Flughaefen, da wir ja immer aus Portugal kommen muessen.
Hat vielleicht jemand eine Idee? vielen dank im Voraus-
connyhumboldt antwortete vor 1 Woche, 2 Tagen
Hallo! Die beste Klinik für Diabetes ist in Bad Mergentheim! Ich hoffe Euch damit geholfen zu haben! Die Gesetzlichen Krankenkassen schicken die bei ihnen versicherten Diabetiker alle dahin! Privat geht aber auch? Liebe Grüße aus dem kalten Deutschland!
-










Hey, ich bin Lara und 23 Jahre alt. Ich komme zwar nicht aus Berlin, aber bin im Mai wieder dort. Freue mich trotzdem immer über Austausch, auch wenn es digital ist. Liebe Grüße
@laratyp1life: Hallo, über digitalen Austausch freue ich mich natürlich auch 🙂