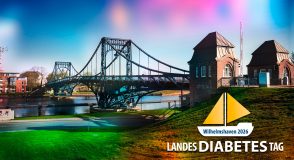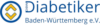- Technik
Geballte Fortbildung in Technologie
6 Minuten

Zum dritten Mal fand die DiaTec-Fortbildung in Berlin statt – die Teilnehmerzahl war im Vergleich zu den Vorjahren noch einmal deutlich gestiegen. Das Programm bot wieder eine große Themenvielfalt aus dem Bereich der Diabetestechnologie. Alles war interessant und informativ, einige der Beiträge stellen wir Ihnen im Folgenden zusammengefasst vor.
Kombination aus Wissenschaft und Fortbildung
Zwei Tage Fortbildung zu Diabetestechnologie in Kombination mit der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft diabetologische Technologie (AGDT) bot die Veranstaltung DiaTec 2014 Ende Januar in Berlin. “Ziel ist, eine Kombination aus Wissenschaft und Fortbildung zu erreichen”, begrüßte Professor Dr. Lutz Heinemann, Organisator der Veranstaltung, die 243 Teilnehmer.
Diabetologen, Diabetesberaterinnen und andere Diabetesexperten nutzten die Möglichkeit, sich zu informieren. Das Hauptthema in diesem Jahr war “Needles and Pens”.
Kanülen immer dünner
r. Dorothee Deiss aus Berlin stellte bei der Suche nach Informationen zu ihrem Einführungsvortrag fest: “Ich war fasziniert, welche Technik in den kleinen Nadeln steckt.” Vor allem der heute kaum noch vorhandene Schmerz beim Spritzen hat sich durch die Forschung und Weiterentwicklung in diesem Bereich massiv reduziert.
Trotzdem spielt die Angst vor Schmerzen beim Injizieren auch heute noch eine große Rolle, denn viele Diabetesexperten beeinflussen über ihre Angst vor dem vermeintlichen Schmerz ihre Patienten. Die Kanülen haben in den letzten 30 Jahren eine enorme Entwicklung erlebt: Während sie im Jahr 1985 noch eine Länge von 16 mm und einen Durchmesser von 27 G hatten, gibt es heute Kanülen mit einer Länge von 4 mm und einem Durchmesser von 33 G.
4 mm Länge reichen
Dass eine Kanülenlänge von 4 mm reicht, bewies die Berliner Diabetologin. Sie zeigte eine Studie (Gibney MA et al., Curr Med Res Opin 2010; 26: 1519 – 1530), in der nachgewiesen wurde, dass die Hautdicke an Arm, Bauch, Oberschenkel und Gesäß im Durchschnitt weniger als 2,5 mm beträgt, unabhängig von Geschlecht, Ethnizität und Body-Mass-Index. Konsequenz: “Die Nadel muss nur lang genug sein, um durch die Dermis zu gelangen, und kurz genug, um nicht die Muskelfaszie zu berühren.”
Zwei Untersuchungen (Hirsch LJ et al., Curr Med Res Opin 2010; 26: 1531 – 1541; Hirsch LJ et al., Curr Med Res Opin 2012; 28: 1305 – 1311) haben gezeigt, dass das bei Kanülen mit den Längen 4 und 5 mm der Fall ist; mit 6 mm Länge geht es zum Teil in den Muskel, mit 8 mm vollständig. Bei Kindern ist die Hautdicke altersabhängig, aber 4 mm reichen bei ihnen laut Deiss immer.
Intradermal schnellere Insulinwirkung
Eine weitere Entwicklung im Kanülensektor sind Mikronadeln. Sie ermöglichen eine intradermale Injektion. In einer Studie mit Kindern (Norman JJ et al., Pediatr Diabetes 2013; 14: 459 – 465) ließ sich zeigen, dass dadurch das Insulin schneller an- und abflutet als bei subkutaner Injektion.
Kanülen einfach oder mehrfach nutzen?
Einen weiteren Aspekt der Insulininjektion griff die Diabeteswissenschaftlerin Doris Schöning aus Rheine auf: die Dauer der Verwendung von Kanülen. Dabei war sie auf einen Widerspruch gestoßen: In der S3-Leitlinie “Therapie des Typ-1-Diabetes” aus dem Jahr 2011 heißt es: “Injektionsspritzen und Penkanülen können mehrfach verwendet werden.”
Liest man die Kurzfassung der Leitlinie Therapie des Typ-1-Diabetes, ebenfalls aus dem Jahr 2011, findet man: “Darüber hinaus sollte eine Aufklärung über den Einmalgebrauch von Injektionsnadeln erfolgen (…).” In der Weiterbildung der Diabetesberaterinnen wird darüber diskutiert, in der Ausbildung der Diabetesassistentinnen fehlt dafür, sagte Schöning, die Zeit.
Insulinpens regelmäßig überprüfen
Eine interessante Beobachtung machte Dr. Dirk Hochlenert aus Köln: Bei mehreren Diabetestagen in Köln hat er sich, zusammen mit seinem Team, die im Gebrauch befindlichen Insulinpens der Besucher angesehen. “Wir haben fünf Pens gefunden, die ganz offensichtlich kaputt waren” – was aber die Besitzer der Insulinpens nicht daran hinderte, sie zu verwenden. Hochlenert: “Die Pentechnik ist sehr robust.” Sein dringender Appell aber lautete: Insulinpens sollten regelmäßig überprüft werden.
Fehlerhafte Messungen interessieren nicht
Über ein frustrierendes Erlebnis, das den offiziellen Umgang mit fehlerhaften Blutzuckermessgeräten bzw. Blutzuckerteststreifen zeigt, berichtete Dr. Guido Freckmann vom Institut für Diabetes-Technologie (IDT) in Ulm. Im Rahmen einer Studie, in der die Messgenauigkeit unterschiedlicher Blutzuckermesssysteme untersucht wurde, ergaben sich für ein System Abweichungen, die den Rahmen des Erlaubten deutlich überschritten.
Das IDT meldete den Fall im Oktober 2012 dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Nachdem der Vertreiber des Messsystems mit Kontrolllösungsmessungen das System überprüft hatte, stellte das BfArM im Januar 2013 das Verfahren ein.
Eine Nachtestung durch das IDT ergab wiederum Probleme mit der Genauigkeit, so dass erneut eine Meldung ans BfArM im Juli 2013 erfolgte, im Oktober 2013 wurde der Vertreiber selbst vom BfArM informiert, woraufhin das Unternehmen alle Teststreifen, die von ihm noch beim IDT waren, abholte. Seitdem herrscht Funkstille …
Nützliche Boluskalkulatoren bei Begleitung
Sind Boluskalkulatoren sinnvoll? Dieser Frage widmete sich Sandra Schlüter aus einer diabetologischen Schwerpunktpraxis in Northeim. Bereits im Jahr 2008 hatten in einer Studie 59 % der untersuchten erwachsenen Diabetiker gezeigt, dass sie Probleme hatten, eine Insulindosis anhand von BE-Faktor und Korrekturfaktor korrekt zu berechnen (Cavanaugh K et al., Ann Intern Med 2008; 148: 737 – 746).
In diesen Fällen ist der Einsatz eines Bolusrechners sinnvoll, meinte Schlüter. Solche Dosisrechner bieten auch medizinisch Vorteile: Mit ihrer Unterstützung können Diabetiker ihre HbA1c-Werte besser reduzieren als ohne (Maurizi AR et al., Diabetes Technol Ther 2011; 13: 425 – 428).
Außerdem steigt durch ihre Anwendung die Blutzuckermessfrequenz und das Wohlbefinden der Diabetiker bessert sich (Barnard K et al., J Diabetes Sci Technol 2012; 6: 144 – 149). Wichtig beim Einsatz eines Bolusrechners ist aus Sicht von Schlüter, dass der Patient dabei begleitet wird; dann ist diese Therapieunterstützung sinnvoll und nützlich.
Mahlzeiten einschätzen mit Smartphones
Ein großer Unsicherheitsfaktor bei der Bolusberechnung ist die Abschätzung der Kohlenhydrate in einer Mahlzeit. Und werden die Kohlenhydratmengen falsch eingeschätzt, kann das relevante Auswirkungen auf die berechnete Insulindosis haben. Mit dem Projekt GoCARB der Universität Bern möchten Professor Dr. Peter Diem und sein Team hierbei Unterstützung bieten. Sie wollen erreichen, dass in Fotos von Mahlzeiten mit einem Smartphone die einzelnen Bestandteile erkannt und in ihrem Kohlenhydratgehalt berechnet werden.
Allerdings ist es nicht einfach, wie Diem zugab, die Einzelbestandteile der Mahlzeiten korrekt zuzuordnen. Erreicht haben sie bereits eine Zuverlässigkeit von 87% bei 3 500 Fotos von Dummy-Mahlzeiten aus zehn Bereichen, z. B. Salat, Paniertes, Fleisch, Nudeln, Brot und Gemüse – aber es werden durchaus Lebensmittel noch nicht richtig erkannt.
Um die Portionsgröße einschätzen zu können, erfolgt ein fotografischer Abgleich mit einer Kreditkarte, die dem System vorher bekannt ist, außerdem müssen die Mahlzeiten aus zwei Richtungen fotografiert werden, so dass eine 3D-Darstellung möglich wird. Eine klinische Studie mit 20 Patienten ist bereits geplant.
Konstante oder variable Basalrate?
Bringen in Insulinpumpen konstante oder variable Basalraten bessere Erfolge? Klar ist, sagte Dr. Andreas Reichel aus Dresden, dass hormonell betrachtet eine Variabilität im Insulinbedarf festzustellen ist; das belegen verschiedene auch ältere Studien (Bolli et al., Diabetes 1984; 33: 1150 – 1153; Lepore M et al., Diabetes 2000; 49: 2142 – 2148).
Problem ist, dass keine randomisierten, kontrollierten Studien vorliegen, die konstante und variable Basalraten in der Insulinpumpentherapie verglichen. Dennoch ist das nach Überzeugung Reichels kein Beleg dafür, dass variable Basalraten nicht sinnvoll seien. “Abwesenheit von Evidenz ist nicht Evidenz für Abwesenheit”, betonte der Diabetologe.
Datenverwaltung mit vielen Unterschieden
Wer in der Praxis Daten aus Blutzuckermessgeräten ausliest, hat ein Problem: Eine Standardisierung fehlt. Bis heute bieten die Hersteller unterschiedliche Verbindungskabel an, um das Messgerät mit einem Computer zu verbinden. Hier scheint sich aber eine Entwicklung anzubahnen: Für immer mehr neue Geräte reicht ein handelsübliches Standard-USB-Kabel, berichtete Oliver Ebert aus Stuttgart, und einzelne Geräte können ohne Kabel direkt in einen der Anschlüsse des Computers gesteckt werden.
Daher wird sich bald auch ein weiteres Problemfeld zunehmend relativieren, nämlich die Hardwaretreiber für die Geräte: Sind sie nicht korrekt installiert, funktioniert das Auslesen nicht. Kommen nacheinander Patienten mit verschiedenen Blutzuckermessgeräten, muss ständig ein Kabel herausgezogen und ein anderes hineingesteckt werden, was laut Ebert unter
Daten vielfältig darstellen
Auch für die Darstellung der ausgelesenen Daten existiert keine Standardisierung. Schwierigkeiten, dies zu vereinheitlichen, sieht Ebert darin, dass es unterschiedliche Auswertungstypen gibt, unterschiedliche Visualisierung, unterschiedliche “Schulen” in der diabetologischen Ausbildung. Außerdem sind die Erwartungshorizonte der Anwender nicht einheitlich und auch kulturell und regional bestehen Unterschiede.
Die einen mögen Blutzuckerwerte, die als einzelne Punkte dargestellt sind, die anderen verbundene Punkte. Für die nächsten ist die Tabellenansicht die beste Variante, wieder andere möchten die Durchschnittswerte sehen. Und die Farbgestaltung kann ebenfalls variieren.
“Wer hat recht? Was soll man hier vorschreiben?”, fragte Ebert aufgrund der Darstellungsvielfalt die Teilnehmer. Es gibt Vorschläge zur Vereinheitlichung (z. B. Bergenstal RM et al., Diabetes Technol Ther 2013; 15: 198 – 211), allerdings meinte Ebert, dass zwar ein Mindestkonsens möglich sei, aber mehr nicht sinnvoll. Ein Projekt zur Vereinheitlichung ist glucoNET.
Um das Programm einsetzen zu können, erhält der Patient vom Arzt eine eindeutige glucoNET-ID, der Patient liest sein Messgerät egal welchen Herstellers zu Hause aus oder erfasst die Daten mit einer App. Anschließend verschickt er die Daten an seinen Arzt, wo sie in einem einheitlichen Format angeliefert werden und auf Knopfdruck in einer Diabetes-Software bereitstehen.
Fazit
Gut besuchte Vorträge, viele Gespräche, eine informative Ausstellung der Diabetestechnologie herstellenden Industrie: Das war die DiaTec-Fortbildung 2014. Es gab drei Seminarblöcke zu den Themen Needles and Pens und CSII, SMBG und CGM und CSII und Artificial Pancreas mit insgesamt 15 Vorträgen, drei weitere Vorträge gab es zum Abschluss.
Außerdem fanden drei Workshopblöcke statt, aus denen man sich in jedem Block einen auswählen konnte. Eine Podiumsdiskussion und eine Pro-und-Kontra-Diskussion rundeten die zwei Fortbildungstage ab. Im Jahr 2015 geht es weiter am 23. und 24. Januar.
Erschienen in: Diabetes und Technologie, 2014; 6 (1) Seite 10-13
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Ernährung
Community-Rezept: Vietnamesische Sommerrollen mit Gambas von Chrissi

3 Minuten
Keine Kommentare
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
bloodychaos postete ein Update vor 3 Tagen, 11 Stunden
Hat noch jemand Probleme mit dem Dexcom G7? Nachdem ich letztes Jahr im Sommer über drei Monate massive Probleme mit dem G7 hatte bin ich zum G6 zurückgewechselt. Jetzt zum Jahreswechsel bzw. jetzt Ende Februar wollte ich dem G7 mal wieder eine Change geben. Ich war davon ausgegangen, dass die Produktionsprobleme inzwischen behoben sind. Aber spätestens am dritten Tag habe ich massive Abweichungen von 50 – 70 mg/dL. Setzstellenunabhängig. Meine aktuellen G7 wurden im Dezember 2025 produziert. Also sollten die bekannten Probleme längst behoben worden sein. Zuerst lief es die ersten Monate von 2025 mit dem G7 super, aber im Frühjahr 2025 fingen dann die Probleme an und seitdem läuft der G7 nicht mehr bei mir, obwohl alle sagen, dass die Probleme längst behoben seien und der Sensor so toll funktioniert. Ich habe echt Angst. Mir schlägt das sehr auf die Psyche. Zumal ich die TSlim nutze, die nur mit Dexcom kompatibel ist und selbst wenn ich zur Ypsopump wechsel ist da der Druck, dass es mit dem Libre3 funktionieren MUSS. Ich verstehe nicht, warum der G7 bei allen so super läuft, nur ich bin die Komische, bei der er nicht funktioniert.
-
ole-t1 antwortete vor 1 Tag, 3 Stunden
Kleine Ergänzung zum MeetUp von gestern.
Wenn ein “klassischer” Pumpenbetrieb ohne AID/Loop eine Option ist, dann tut sich eine breite Auswahl an CGM auf, die momentan auf dem deutschen Markt verfügbar sind:
Freestyle Libre 3 bzw. 3+
Dexcom G7
Dexcom G6 (noch)
Medtronic Guardian 4 (nur mit Medtronic-Pumpe)
Medtronic Simplera (nur mit Medtronic-Pumpe oder -Smartpen)
Eversense (implantiert für 1/2 Jahr, wird oft bei Pflasterallergien genutzt)
Accu-Chek Smartguide CGM
Medtrum Touchcare Nano CGMIch würde schätzen, dass die Reihenfolge ungefähr den Verbreitungsgrad widerspiegelt. Von Medtrum würde ich mir z.B. keinen grandiosen Kundenservice erhoffen. Aber wer weiß…?
Mag sein, dass ich etwas vergessen habe, aber die wichtigesten müssten dabei sein.
-
-
thomas55 postete ein Update vor 1 Woche
Hallo,
ich habe zur Zeit die Medtronic Minimed 670G mit Libre als Sensor. Ich überlege, auf die 780G als AID mit dem Simplera umzusteigen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Sensor? Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? In der Vergangenheit wurden Neukunden der 780G nicht mit dem Simplera beliefert sondern nur Kunden, die die 780G schon länger nutzen. Das hat sich nach Aussagen von Medtronic-Mitarbeitern beim T1day heute genau umgekehrt. Mein Doc hat das vestätigt. Für mich als neuer Bezieher der 780G gut, für die Bestandskunden schlecht.
Danke vorab und bleibt gesund (von unserem Typ 1 lassen wir uns das Leben dank Technik nicht vermiesen!)
Thomas55 -
sayuri postete ein Update vor 1 Woche, 1 Tag
Hi, ich bin zum ersten Mal hier, um mich für meinen Freund mit Diabetes Typ 1 mit anderen auszutauschen zu können. Er versteht nicht alles auf Deutsch, daher schreibe ich hier. Etwa vor einem Jahr wurde ihm der Diabetes diagnostiziert und macht noch viele neue Erfahrungen, hat aber auch Schwierigkeiten, z.B. die Menge von Insulin besser abzuschätzen. Er überlegt sich, mal die Patch-Pad am Arm auszuprobieren. Kann jemand uns etwas über eingene Erfahrungen damit erzählen? Ich wäre sehr dankbar!🤗🙏
Liebe Grüße
Sayuri