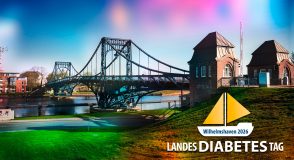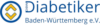- Begleit-Erkrankungen
Experten-Interview: Gesundheit beginnt im Mund – vor allem bei Diabetes
5 Minuten
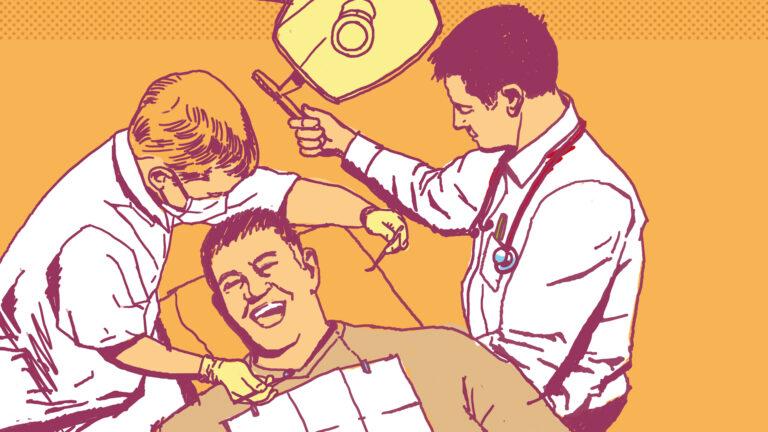
Der Parodontologe Prof. Dr. Thomas Kocher und der Diabetologe PD Dr. Erhard Siegel erklären im Diabetes-Journal-Interview, wieso vor allem für Menschen mit Diabetes die Gesundheit im Mund beginnt.
Im Interview: PD Dr. Erhard Siegel und Prof. Dr. Thomas Kocher
Privatdozent Dr. med. Erhard Siegel ist Präsident der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG). Der Ärztliche Direktor der Klinik für Gastroenterologie, Diabetologie und Ernährungsmedizin am St. Josefskrankenhaus Heidelberg GmbH wurde in Backnang/Baden-Württemberg geboren und studierte Medizin in Heidelberg, Tübingen und Göttingen. Nach seiner Habilitation zum Thema “Pathophysiologie und therapeutische Ansätze des hepatogenen Diabetes” ernannte ihn die Christian-Albrechts-Universität im Februar 2001 zum Privatdozenten.

Prof. Dr. med. dent. Thomas Kocher ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie e.V. Nach seiner Promotion und verschiedenen Stationen an Zahnkliniken in Tübingen, Göteborg (Schweden), Münster und Kiel ist er seit 1995 Leiter der Abteilung Parodontologie im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Seine Fachgebiete umfassen epidemiologische Aspekte der Parodontalerkrankungen, Wurzeloberflächenbearbeitung (Entwicklung von Instrumenten und deren präklinische und klinische Prüfung) sowie die Interaktion Parodontitis/Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Diabetes-Journal (DJ): Was verbindet Menschen mit Diabetes und Parodontitis-Patienten?
PD Dr. Erhard Siegel: Beide Krankheiten kann man aufgrund ihres hohen Verbreitungsgrades als Volkskrankheiten bezeichnen. Und die Verbreitung von Diabetes steigt europaweit kontinuierlich an. Die hohe Dunkelziffer mit eingerechnet leiden heute schätzungsweise mehr als 8 Millionen Menschen in Deutschland an Diabetes. Neben den schon lange bekannten Spätfolgen des Diabetes mellitus wie Schädigung der Arterien (Makroangiopathien), Erkrankungen des peripheren Nervensystems (Neuropathien), der Nieren (Nephropathien) und der Netzhaut (Retinopathien) sowie deren Folgen wird heute auch von der Parodontitis (Entzündung des Zahnhalteapparates) als einer weiteren wichtigen Diabetesfolgeerkrankung gesprochen.
Prof. Dr. Thomas Kocher: An Parodontitis sind bereits ca. 15 bis 20 Prozent der deutschen Bevölkerung schwer erkrankt. Zwischen Parodontitis und einem Diabetes mellitus bestehen enge – für die Betroffenen äußerst ungünstige – Wechselbeziehungen: Für Diabetespatienten besteht die Gefahr einer chronischen Parodontitis. Parodontitispatienten wiederum besitzen ein erhöhtes Risiko, an Diabetes zu erkranken.
PD Dr. Siegel: Denn eine Parodontitis wirkt sich nicht nur negativ auf einen vorhandenen Diabetes aus, sondern kann ihn auch auslösen!
DJ: Was spricht dafür, dass Zahnärzte und Diabetologen neben ihrem eigentlichen Behandlungsgebiet auch über den fachlichen Tellerrand schauen?
PD Dr. Siegel: Da sowohl die Parodontitis als auch der Diabetes mellitus Systemerkrankungen sind, die über Organ-, Sektor- und Fachgrenzen hinausgehen und sich wechselseitig beeinflussen, erfordert die optimale Behandlung der Parodontitis bei Diabetes einen ganzheitlichen Ansatz, der Zahnmedizin und Diabetologie einschließt. Eine effektive Behandlung der parodontalen Entzündung kann nicht nur die lokalen Symptome der Erkrankung des Parodonts verbessern, sondern kann auch den Status und damit die Einstellbarkeit des Diabetes verbessern.
Prof. Dr. Kocher: Hierbei ist entscheidend, die Parodontalbehandlung sehr sorgfältig und professionell durchzuführen, um die gewünschten Effekte zu erreichen – darauf lässt eine aktuelle amerikanische Studie schließen. Weiterhin ist die Betreuung des parodontal erkrankten Patienten wie auch des Diabetikers lebenslang notwendig. Die Patienten müssen in hohem Maße kooperativ und diszipliniert sein, Behandlungstermine regelmäßig wahrnehmen, damit positive Ergebnisse über lange Zeit beibehalten werden. Haus- und Zahnärzte sollten ihre Patienten mit einer Stimme unterstützen, beraten und auch motivieren, um einen nachhaltigen und bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen.
DJ: Wie können Zahnärzte das Diabetes-Management ihrer Patienten unterstützen?
Prof. Dr. Kocher: Bei allen neu diagnostizierten Typ-1- und Typ-2-Diabetikern sollten parodontale Untersuchungen durch den Zahnarzt zur Routine in der Diabetesbehandlung werden. Kinder und Jugendliche mit der Diagnose Diabetes sollten bereits ab dem 6. bzw. 7. Lebensjahr jährlich von einem Zahnarzt untersucht werden.
Im Rahmen der Erstuntersuchung beim Zahnarzt sollten daher auch bei Verdachtsmomenten eine ausführliche Anamnese und ggf. ein Blutzuckertest durchgeführt werden. Dies gilt auch für Patienten, die sich ohne Diabetesdiagnose, aber mit offensichtlichen Risikofaktoren für einen Typ-2-Diabetes (Übergewicht, Bluthochdruck, positive Diabetes-Familienanamnese) und Zeichen einer Parodontitis beim Zahnarzt vorstellen. So können Risikopatienten schon präventiv gezielt zum Diabetologen überwiesen werden.
DJ: Wie können behandelnde Ärzte erkennen, dass ihre Patienten ggf. an Parodontitis erkrankt sind?
PD Dr. Siegel: Aufgrund der gut belegten wechselseitigen Beeinflussung von Parodontitis und Diabetes mellitus sollten Fragen nach Parodontalerkrankungen in die Anamnese bei der routinemäßigen Untersuchung von Diabetespatienten aufgenommen werden. Das kann mit Hilfe eines standardisierten Fragebogens erfolgen (Anmerkung: siehe unten).
Ferner weisen offenkundige Symptome der Parodontitis wie Mundgeruch, Zahnfleischbluten, gelockerte Zähne, Zahnwanderungen und/oder Zahnfleischabszesse auf eine manifeste Erkrankung hin – und der Diabetiker sollte zur Parodontalbehandlung an den Zahnarzt überwiesen werden.
Bei einer schwierigen Einstellung des Blutzuckers muss immer an das Vorhandensein einer Parodontalerkrankung gedacht werden. Das Vorhandensein schwerer Parodontitiden erhöht die Insulinresistenz der Gewebe und erschwert so die Einstellung des Blutzuckers. Eine Parodontitis beeinflusst einen Diabetes negativ und kann zu einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels und auch des HbA1c-Wertes bei Diabetikern führen.
DJ: Ist bei Typ-1- und Typ-2-Diabetikern das Risiko, an Parodontitis zu erkranken, gleich hoch?
PD Dr. Siegel: Typ-2-Diabetiker wie auch Typ-1-Diabetiker haben ein 3-fach höheres Risiko für eine Parodontalerkrankung als Nichtdiabetiker. Außerdem erhöht ein schlecht eingestellter Diabetes das Risiko für Knochenverlust im Kiefer und für einen schwereren Verlauf der Parodontitis. Ein gut eingestellter Diabetiker hat dagegen kein höheres Risiko als ein Gesunder.
DJ: Was tun Sie als medizinische Fachgesellschaft dafür, um das Bewusstsein und die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit zu stärken?
PD Dr. Siegel: Unsere beiden Verbände haben sich zusammengetan, um gemeinsam für eine bessere Aufklärung bei Haus- und Fachärzten zu sorgen. Wenn wir eine bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern möchten, müssen wir selber auch mit positivem Beispiel vorangehen.
Kocher: Wir haben als DGParo eine umfangreiche Aufklärungskampagne gestartet und versuchen beispielsweise über die einschlägige Fachpresse, eine größtmögliche Reichweite unter Zahnärzten zu erzielen. Gemeinsam mit der DDG sprechen wir gezielt Allgemeinmediziner und Diabetologen an. Auch unsere Internetseiten bieten ausführliche Informationen. Denn angesichts der Beziehung zwischen beiden Erkrankungen erfordert die erfolgreiche Behandlung der Diabetespatienten einen ganzheitlichen Ansatz, der auch die Zahnmedizin mit einbezieht. Dafür muss das interdisziplinäre Bewusstsein für parodontale Erkrankungen als Folge des Diabetes mellitus geschaffen bzw. geschärft werden. Vor diesem Hintergrund sollte künftig die fachübergreifende Kooperation zwischen zahnärztlich, hausärztlich oder internistisch tätigen Medizinern intensiviert und weiter ausgebaut werden.
DJ: Was kann man tun, um Patienten besser und zielgerichtet aufzuklären? Was tun Sie bereits, wo gibt es noch Handlungsbedarf?
Prof. Dr. Kocher: Haus- und Zahnärzte sind wohl die Ärzte, die am häufigsten aufgesucht werden. Wir sehen sie daher in der Verantwortung, auch im Hinblick auf Diabetes mellitus und Parodontitis ganzheitliche Zusammenhänge zu erkennen, eine Erstberatung zu leisten und an entsprechende Fachärzte weiterzuverweisen. Die Sensibilisierung der Ärzte für diese Zusammenhänge ist daher aus unserer Sicht der beste Dienst, den wir den Patienten erweisen können. Unsere Aufklärungskampagne richtet sich aber auch an die Patienten direkt, denn nur ein mündiger Patient kann im Zweifel die richtigen Hinweise geben bzw. die richtigen Fragen stellen.
PD Dr. Siegel: Patienten mit Diabetes sollten wissen, dass das Parodontitis- und Zahnverlustrisiko durch einen Diabetes erhöht wird. Wenn sie bereits an Parodontitis erkrankt sind, müssen sie darüber informiert werden, dass ihre Blutzuckereinstellung schwieriger sein kann und sie ein höheres Risiko für diabetische Komplikationen wie Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen haben.
Prof. Dr. Kocher: Im Zusammenhang mit dem erhöhten parodontalen Erkrankungsrisiko und den damit verbundenen Komplikationen müssen sie besonders über die Bedeutung der täglichen häuslichen Mundhygiene wie auch über die notwendige lebenslange Betreuung durch ihren Zahnarzt aufgeklärt werden. Neben der regelmäßigen täglichen Entfernung der Plaque (Zahnbelag) mit Hilfe einer Zahnbürste gehören hierzu auch die regelmäßige Anwendung von Zahnseide oder Zahnzwischenraumbürsten. Diabetespatienten sollten generell, auch ohne Beschwerden, regelmäßig zu den zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen gehen.
DJ: Was kann die Politik tun, um die Möglichkeiten interdisziplinärer Zusammenarbeit zu verbessern?
PD Dr. Siegel: Eine sektorübergreifende Versorgung ist dringend notwendig. Hier ist nicht nur die Politik, sondern auch die Selbstverwaltung der Ärzteschaft gefordert. Derzeit haben wir keine Basis, um überhaupt vom Zahnarzt zum Diabetologen oder umgekehrt überweisen zu können.
DJ: Was ist der wichtigste Rat, den Sie Ihren Patienten mit auf den Weg geben?
Prof. Dr. Kocher: Da ein an Diabetes erkrankter Patient ein erhöhtes parodontales Risiko aufweist, ist eine sehr gute häusliche Mundhygiene wichtig. Wie im allgemeinen Management des Diabetes mellitus ist auch in Bezug auf die Mundpflege eine kooperative und eigenverantwortliche Haltung des Patienten unabdingbar. Patienten sollen regelmäßig zu den zahnärztlichen Kontrolluntersuchungen gehen und eine regelmäßige professionelle Zahnreinigung (PZR) durchführen lassen.
Schwerpunkt „Mundgesundheit: Dem Diabetes auf den Zahn gefühlt“
- Erfahrungsbericht zu Parodontitis und Diabetes: „Sorgenfrei lächeln“
- Wechselwirkung: Gestörte Mundgesundheit ruft hohe Blutzuckerwerte hervor
- Experten-Interview: Gesundheit beginnt im Mund – vor allem bei Diabetes
Interview: Günter Nuber
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2014; 63 (3) Seite 30-33
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Ernährung
Community-Rezept: Vietnamesische Sommerrollen mit Gambas von Chrissi

3 Minuten
Keine Kommentare
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
bloodychaos postete ein Update vor 2 Tagen, 19 Stunden
Hat noch jemand Probleme mit dem Dexcom G7? Nachdem ich letztes Jahr im Sommer über drei Monate massive Probleme mit dem G7 hatte bin ich zum G6 zurückgewechselt. Jetzt zum Jahreswechsel bzw. jetzt Ende Februar wollte ich dem G7 mal wieder eine Change geben. Ich war davon ausgegangen, dass die Produktionsprobleme inzwischen behoben sind. Aber spätestens am dritten Tag habe ich massive Abweichungen von 50 – 70 mg/dL. Setzstellenunabhängig. Meine aktuellen G7 wurden im Dezember 2025 produziert. Also sollten die bekannten Probleme längst behoben worden sein. Zuerst lief es die ersten Monate von 2025 mit dem G7 super, aber im Frühjahr 2025 fingen dann die Probleme an und seitdem läuft der G7 nicht mehr bei mir, obwohl alle sagen, dass die Probleme längst behoben seien und der Sensor so toll funktioniert. Ich habe echt Angst. Mir schlägt das sehr auf die Psyche. Zumal ich die TSlim nutze, die nur mit Dexcom kompatibel ist und selbst wenn ich zur Ypsopump wechsel ist da der Druck, dass es mit dem Libre3 funktionieren MUSS. Ich verstehe nicht, warum der G7 bei allen so super läuft, nur ich bin die Komische, bei der er nicht funktioniert.
-
ole-t1 antwortete vor 12 Stunden, 25 Minuten
Kleine Ergänzung zum MeetUp von gestern.
Wenn ein “klassischer” Pumpenbetrieb ohne AID/Loop eine Option ist, dann tut sich eine breite Auswahl an CGM auf, die momentan auf dem deutschen Markt verfügbar sind:
Freestyle Libre 3 bzw. 3+
Dexcom G7
Dexcom G6 (noch)
Medtronic Guardian 4 (nur mit Medtronic-Pumpe)
Medtronic Simplera (nur mit Medtronic-Pumpe oder -Smartpen)
Eversense (implantiert für 1/2 Jahr, wird oft bei Pflasterallergien genutzt)
Accu-Chek Smartguide CGM
Medtrum Touchcare Nano CGMIch würde schätzen, dass die Reihenfolge ungefähr den Verbreitungsgrad widerspiegelt. Von Medtrum würde ich mir z.B. keinen grandiosen Kundenservice erhoffen. Aber wer weiß…?
Mag sein, dass ich etwas vergessen habe, aber die wichtigesten müssten dabei sein.
-
-
thomas55 postete ein Update vor 1 Woche
Hallo,
ich habe zur Zeit die Medtronic Minimed 670G mit Libre als Sensor. Ich überlege, auf die 780G als AID mit dem Simplera umzusteigen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Sensor? Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? In der Vergangenheit wurden Neukunden der 780G nicht mit dem Simplera beliefert sondern nur Kunden, die die 780G schon länger nutzen. Das hat sich nach Aussagen von Medtronic-Mitarbeitern beim T1day heute genau umgekehrt. Mein Doc hat das vestätigt. Für mich als neuer Bezieher der 780G gut, für die Bestandskunden schlecht.
Danke vorab und bleibt gesund (von unserem Typ 1 lassen wir uns das Leben dank Technik nicht vermiesen!)
Thomas55 -
sayuri postete ein Update vor 1 Woche, 1 Tag
Hi, ich bin zum ersten Mal hier, um mich für meinen Freund mit Diabetes Typ 1 mit anderen auszutauschen zu können. Er versteht nicht alles auf Deutsch, daher schreibe ich hier. Etwa vor einem Jahr wurde ihm der Diabetes diagnostiziert und macht noch viele neue Erfahrungen, hat aber auch Schwierigkeiten, z.B. die Menge von Insulin besser abzuschätzen. Er überlegt sich, mal die Patch-Pad am Arm auszuprobieren. Kann jemand uns etwas über eingene Erfahrungen damit erzählen? Ich wäre sehr dankbar!🤗🙏
Liebe Grüße
Sayuri