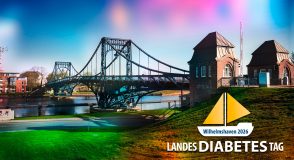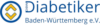- Behandlung
Typ-2-Diabetes und das kranke Herz
4 Minuten

Gefäßstützen, also “Stents”, sind für immer mehr Menschen mit verengten Herzkranzgefäßen eine echte Behandlungsoption, die Erfolg verspricht. Die Entwicklungen sind rasant, denn auch der Eingriff an sich bedeutet heute keine große Operation mehr. Hier geht es um Chancen, Risiken und um die Zeit nach dem Eingriff.
Das Einsetzen von Gefäßstützen (Stentimplantationen) ist durch verbesserte Technik und gewonnene Erfahrungen zur Routinebehandlung geworden und wird immer häufiger ambulant durchgeführt. Vor 25 Jahren wurde noch vorgeschrieben, dass ein Operationsteam dabei anwesend war. War dies nicht vor Ort im Krankenhaus verfügbar, so musste der schnelle Transport in ein Krankenhaus mit Herzchirurgie sichergestellt werden (Hubschrauber in Wartestellung).
In kaum einem anderen Fachgebiet wie in der Kardiologie sind die Entwicklungen so rasant verlaufen. Das Aufgabengebiet der Kardiologen hat sich erweitert: von der konservativen Behandlung der koronaren Herzkrankheit zur Akutbehandlung des Herzinfarktes. Immer mehr Patienten können erfolgreich vom Kardiologen mit Eingriffen (interventionell) behandelt werden, auch Patienten mit angeborenen Herzfehlern und erworbenen Herzklappenerkrankungen. Die Kooperation mit Herzchirurgen und eine gemeinsame Besprechung im Herzteam über die Patienten hat sich als sinnvoll erwiesen.
Parallel zu dieser Entwicklung hat sich die Wahrnehmung der koronaren Herzkrankheit geändert: Galt der Herzinfarkt vor Jahrzehnten als Managerkrankheit, der durch übermäßigen Stress verursacht wird, so wird die koronare Herzkrankheit – auch dank verbesserter Aufklärung – heute als Gefäßerkrankung gesehen, die durch unterschiedliche Risikofaktoren verursacht wird und auch zum Herzinfarkt führen kann. Die Stärkung der Wahrnehmung von Beschwerden führt dazu, dass die Erkrankung früher entdeckt wird, und verbessert die Behandlungschancen im akuten Herzinfarkt, maßgeblich aufgrund frühzeitigerer Einweisung ins Krankenhaus.
Koronare Herzkrankheit behandeln
Bei Einengungen der Herzkranzgefäße kann häufig durch eine Aufdehnung (Dilatation) mit einem Ballonkatheterdie Engstelle beseitigt werden (das Verfahren nennt man Angioplastie), so dass die normale Durchblutung des Herzmuskels wiederhergestellt wird. Stents (Gefäßstützen) reduzieren die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Einengung und werden deshalb in der Regel eingesetzt.
Dank verbesserter Technik und Erfahrungen können immer mehr Patienten hiermit behandelt werden, auch wenn an mehreren Stellen und in verschiedenen Herzkranzgefäßen Einengungen bestehen: im Jahr 2013 waren es ca. 340 000 Angioplastien. Den Patienten wird hierdurch eine Operation erspart, trotzdem gab es 2013 ca. 55 000 Bypassoperationen.
Patienten mit Diabetes profitieren im Vergleich zu Nichtdiabetikern bei diffusen Herzkranzgefäßerkrankungen häufig von einer Bypassoperation. Moderne Techniken verringern die Invasivität der Eingriffe, und die Patienten erholen sich nach der Operation schneller. Die Entscheidungen hierzu (Angioplastie? Operation?) werden gemeinsam von Kardiologen und Herzchirurgen (Herzteam) gefällt. Durch Angioplastie oder Bypassoperation werden die Durchblutung des Herzmuskels verbessert und das Risiko für einen Herzinfarkt deutlich reduziert.
Behandlung nach Stent: Mitarbeit bringt langfristigen Erfolg
Die Stents bestehen aus Edelmetallen und werden durch die Aufdehnung des Ballons, auf den sie montiert sind, an die Gefäßinnenwand gedrückt; sie sind häufig mit Medikamenten beschichtet, die das Wiedereinengungsrisiko deutlich reduzieren. Im Laufe von Monaten werden die Stent-Streben mit einer dünnen Haut überzogen: der inneren Auskleidung der Gefäße (Intima). In dieser Zeit besteht ein Risiko von weit unter 10 Prozent, dass sich Wiedereinengungen an dieser Stelle ausbilden. Um dies und Ablagerungen zu verhindern, werden vorübergehend Medikamente verordnet, die das Verklumpen der Blutplättchen verhindern sollen (Thrombozytenaggregationshemmer).
Die Stelle, an der ein Stent in ein Herzkranzgefäß eingebracht wurde, ist geschützt, das heißt, hier kommt es im Verlauf von 10 Jahren in unter 3 Prozent zu einer erneuten Einengung. Da nach 6 bis 12 Monaten die Einheilung des Stents in die Gefäßwand abgeschlossen ist, wird der Stent formal nicht mehr benötigt. Dies hat zur Entwicklung von selbstauflösenden Stents geführt. Erste Erfahrungen sind erfolgversprechend. An der Stelle, an der sich ein selbstauflösender Stent befand, könnte, falls mit Fortschreiten der Erkrankung erforderlich, ein Bypass aufgenäht werden – im Gegensatz zum Metall-Stent.
Einengung an anderer Stelle: häufig!
In bis zu 40 Prozent entwickeln sich an anderen Stellen bedeutsame Einengungen in den Herzkranzgefäßen. Dieses Risiko kann durch eine optimale Behandlung des Diabetes und der zusätzlichen Risikofaktoren deutlich gemindert werden. Hierzu zählen maßgeblich die Absenkung erhöhter Blutfette und des Blutdrucks in den Zielbereich. Dies kann durch Lebensstiländerungen und regelmäßige Einnahme von Medikamenten erreicht werden. Alle Bluthochdruckerkrankten sollten in die Selbstmessung des Blutdrucks eingewiesen werden und diese dann auch regelmäßig zuhause anwenden. Dies erleichtert die Einstellung und führt häufiger zum Erfolg.
Frühzeitiges Erkennen und Behandeln sichert Lebensqualität
Bei Patienten mit Herzinfarkt sollte so früh wie möglich die Durchblutung des Herzmuskels wiederhergestellt werden, um Narbenbildung im Herzmuskel zu verhindern. Dies verbessert die Langzeitprognose. Die Herzleistung bleibt durch eine frühzeitige Widereröffnung häufig normal – und Herzrhythmusstörungen können verhindert werden. Entscheidend ist die Zeit bis zum Eintreffen im Krankenhaus. Bei Patienten mit Diabetes, die an einer koronaren Herzkrankheit leiden, sind die Beschwerden auch im akuten Herzinfarkt häufig nicht so eindeutig wie bei Nichtdiabetikern, denn die Schmerzempfindung kann auch am Herzen gestört sein. Durch regelmäßige Herzuntersuchungen können das Risiko erkannt und eine weiterführende Diagnostik beim Kardiologen eingeleitet werden.
Die Komplexität der Erkrankung Diabetes erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sowohl bei Ärzten in Praxen als auch im Krankenhaus. In den letzten Jahren haben sich in vielen Regionen Netzwerke zwischen Hausärzten, diabetologischen Schwerpunktpraxen, Kardiologen, Angiologen, Neurologen und Gefäßchirurgen entwickelt mit Anbindung an entsprechend spezialisierte Krankenhäuser. Hierdurch können bei vielen Patienten das individuelle Risiko früher erkannt und Folgeerkrankungen deutlich abgemildert werden – durch entsprechende Behandlungen.
- LDL-Cholesterin unter 70 mg/dl
- Blutdruck unter 140/85 mm
- HgHbA1c um 7 Prozent
- Steigerung der körperlichen Aktivität auf mehr als 5 Stunden Bewegung in der Woche
- Reduktion des Körpergewichts bei Übergewicht
- Rauchverzicht
Patienten können selbst durch Änderungen im Lebensstil hierzu einen deutlichen Beitrag leisten. Schulungsangebote sollte man suchen und wahrnehmen und die Mitgliedschaft in einer Selbsthilfegruppe erwägen. Die Selbstmessung des Blutdrucks und eine sinnvolle Kontrolle der Blutzuckerwerte mit dem Ziel der Angleichung der Therapie tragen zur langfristigen Optimierung der Behandlung bei.
von Dr. Siegfried Eckert
Oberarzt Klinik für Kardiolgie am Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhruniversität Bochum
Georgstraße 11, 32545 Bad Oeynhausen,
E-Mail: seckert@hdz-nrw.de
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2016; 65 (2) Seite 14-18
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Aktuelles
Die Subtypen der Fettleber: Neue Erkenntnisse zu Ursachen und Therapie

3 Minuten
- Technik
Darauf ist zu achten: Sicher mit dem Insulinpen umgehen

3 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
cina_polada postete ein Update vor 2 Tagen
Hi, ich bin Julija und komme aus Frankfurt. Vor ein paar Wochen wurde bei mir Diabetes Typ 2 mit gerade mal 33 Jahren diagnostiziert.. Kämpfe im Moment noch sehr mit der Diagnose und würde mich über etwas Austausch sehr freuen 🙂
-
lauf-chris postete ein Update vor 2 Tagen, 1 Stunde
Ich habe jetzt seit ca 1 Jahr die YpsoPump. Bin gut damit zufrieden. Ist aber auch kein Selbstläufer!
-
marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 3 Tagen, 9 Stunden
Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!