- Behandlung
Nebenwirkungen melden: Wie Arzneimittel noch sicherer werden
4 Minuten

In Deutschland wird die Sicherheit von Arzneimitteln und Medizinprodukten kontinuierlich überwacht – so soll möglichen Problemen bei ihrer Anwendung vorgebeugt oder abgeholfen werden. Deshalb ist es wichtig, Nebenwirkungen zu melden. Wie das geschieht, beschreiben Dr. André Said und Prof. Martin Schulz von der Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker.
Nebenwirkungen zu melden, trägt dazu bei, dass das Risikoprofil von Arzneimitteln besser verstanden wird und gesundheitliche Schäden für Patienten vermieden werden können.
Die Überwachung der Arzneimittelsicherheit in Deutschland
Die Überwachung der Arzneimittelsicherheit, auch bekannt als Pharmakovigilanz, umfasst alle Tätigkeiten, die sich mit dem Erkennen, dem Bewerten, dem Verständnis und der Prävention von Risiken im Zusammenhang mit dem Anwenden von Arzneimitteln befassen. Hierzu gehört insbesondere die kontinuierliche und systematische Sammlung von Meldungen zu möglichen (neuen) Nebenwirkungen von Arzneimitteln durch die zuständigen Stellen und Behörden.
Dies ist notwendig, da die Kenntnisse zur Sicherheit von Arzneimitteln zunächst aus den Phasen der klinischen Prüfung in der Entwicklung kommen. Dabei wendet eine relativ geringe Zahl ausgesuchter Patienten Arzneimittel unter streng kontrollierten Bedingungen an. Hinweise auf seltene und sehr seltene Nebenwirkungen können hier noch nicht oder nur unzureichend erkannt werden; dies gilt auch für (potenzielle) Wechselwirkungen und andere Probleme im Zusammenhang mit der Arzneimittelanwendung im Alltag.
Die fortlaufende Überwachung der Arzneimittelsicherheit, auch nach Zulassung, garantiert somit den sicheren, rationalen und wirksamen Einsatz von Arzneimitteln. Denn auf Basis der gesammelten Informationen und Daten können notwendige Maßnahmen zur Abwehr (neu) identifizierter Arzneimittelrisiken entwickelt, kommuniziert und umgesetzt werden. Insbesondere Patienten werden daher gebeten, vermutete Nebenwirkungen zu melden und damit einen aktiven Beitrag zu leisten, die Arzneimittelsicherheit zu erhöhen.
Wie werden Nebenwirkungen gemeldet?
Sobald vermutet wird, dass eine Nebenwirkung im Zusammenhang mit der Arzneimittelanwendung auftrat, sollten sich Patienten und Patientinnen an ihren Arzt oder ihren Apotheker wenden. Dies gilt insbesondere für Nebenwirkungen, die (noch) nicht im Beipackzettel genannt sind.
Für das Melden eines Verdachtsfalls einer Nebenwirkung nutzen Ärzte und Apotheker ein etabliertes Berichtssystem für Heilberufe mit standardisierten Meldebögen. In der Arztpraxis oder in der Apotheke können diese zusammen mit dem Patienten ausgefüllt und an die zuständige Stelle weitergeleitet werden. Alternativ stehen Patienten auch direkt Online-Meldeformulare der nationalen Behörden, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI), zur Verfügung (www.nebenwirkungen.pei.de).
In jedem Fall stehen Ärzte und Apotheker bei Bedarf helfend zur Seite, um zu erkennen, ob es sich um eine Reaktion auf ein Arzneimittel handelt, also eine vermutete Nebenwirkung, oder andere Ursachen in Frage kommen. Ob das Ereignis in jedem Fall durch das in Verdacht stehende Arzneimittel hervorgerufen wurde, ist allerdings nicht vom Meldenden zu entscheiden. Dies wird nach Begutachtung und Bewertung des Berichts durch die zuständige Stelle vorgenommen. In Deutschland sind dies BfArM und PEI sowie die Pharmakovigilanz-Zentren der Heilberufe.
Folgende Angaben sind bei einer Meldung in jedem Fall zu machen:
- Information zum betroffenen Patienten: Initialen, Alter, Geschlecht
- Nebenwirkung(en), die aufgetreten ist/sind
- Handelsname und/oder Wirkstoffbezeichnung sowie Dosierung des Arzneimittels, von dem vermutet wird, dass es zu einer Nebenwirkung geführt hat (falls möglich, auch Angabe der Chargen-Nummer)
- Name und Kontaktdaten des Meldenden (Apotheker/Arzt)
Wenn möglich, sollten zu einer Meldung auch folgende (ergänzende) Angaben gemacht werden:
- Angabe aller Arzneimittel, die zur gleichen Zeit angewendet wurden (auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel usw.)
- individueller Gesundheitsstatus mit sämtlichen Grund- und Begleiterkrankungen
- Angaben zur Verbesserung oder Verschlechterung der Symptome nach Absetzen des verdächtigten Arzneimittels oder nach wiederholter Anwendung
- Schwere der Nebenwirkungen, inklusive der Folgen für den Patienten/die Patientin
- Maßnahmen/Therapien zur Symptomlinderung sowie relevante Untersuchungsergebnisse
- sollten Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einem möglichen Qualitätsmangel des Arzneimittels stehen, sind auch Informationen hierzu anzugeben und das Arzneimittel ggf. für weitere Untersuchungen dem meldenden Arzt/Apotheker zu überlassen
Um die zuständigen Stellen bei der Bewertung von Ursache und Wirkung zu unterstützen, ist es daher bedeutsam, alle wichtigen Informationen so vollumfänglich und konkret wie möglich im Rahmen einer Meldung anzugeben (siehe Kasten oben). Aus diesem Grund ist es von Vorteil, wenn Patienten oder deren Angehörige den Meldebogen idealerweise von ihrem Arzt oder ihrem Apotheker ausfüllen lassen.
Alle persönlichen Daten im Zusammenhang mit der Meldung werden dabei gemäß den europäischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet und ausschließlich zum Zweck der wissenschaftlichen Bewertung eines Arzneimittelrisikos verwendet. Sind dringende Rückfragen durch die zuständigen Stellen nötig, ist es überdies wichtig, dass der meldende Arzt oder der meldende Apotheker die Kontaktdaten des Patienten intern (also nur für sich) dokumentiert.
Was passiert mit einer Meldung, nachdem sie verschickt wurde?
Alle in Deutschland berichteten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen werden von den zuständigen Stellen und Behörden gesammelt und hinsichtlich Vollständigkeit und Qualität geprüft. Für meldende Apotheker übernimmt dies die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) in Berlin. Die Verdachtsfälle werden gemäß nationalen Vorgaben an die jeweilige Behörde, BfArM oder PEI, weitergeleitet und in eine europäische Datenbank für Nebenwirkungsverdachtsfälle (EudraVigilance) eingepflegt. Die gesammelten Informationen stehen dann europaweit der kontinuierlichen und systematischen Arzneimittelüberwachung zur Verfügung.
Sollten sich aufgrund der eingehenden Daten neue Hinweise (Signale) für potenzielle Arzneimittelrisiken ergeben, werden diese geprüft und ggf. erforderliche Maßnahmen eingeleitet. So können sich, je nach Art und Schwere des Risikos, das Ergänzen von neuen Warnhinweisen in den Produktinformationen oder neue Anwendungsbeschränkungen ergeben, es kann aber auch zum kompletten Verbot des weiteren Inverkehrbringens des Arzneimittels kommen.
Über die neu bekannt gewordenen Risiken bzw. über die notwendigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr werden die Heilberufe informiert, die ihrerseits dafür Sorge tragen, dass die Patientensicherheit gewahrt bleibt. In besonderen Fällen kann die zuständige Behörde die Öffentlichkeit auch direkt über Arzneimittelrisiken informieren.
Wo sind Informationen zu Nebenwirkungen zu finden?
In den Gebrauchsinformationen der Arzneimittel (Beipackzettel) sind die bislang bekannten möglichen Nebenwirkungen entsprechend ihrer Häufigkeit des Auftretens ausgewiesen. Weiterhin finden sich in einer öffentlich zugänglichen europäischen Datenbank (siehe folgenden Kasten) all jene Ereignisse, die bislang im Rahmen der Anwendung eines Arzneimittels beobachtet und berichtet wurden.
Weitere Infos
- Sprechen Sie für die Meldung eines Verdachtsfalls einer Nebenwirkung Ihren Arzt oder Apotheker an. Alternativ stehen Ihnen auch Online-Meldeformulare zur Verfügung: www.nebenwirkungen.pei.de
- In der öffentlich zugänglichen „Europäischen Datenbank gemeldeter Verdachtsfälle von Arzneimittelnebenwirkungen“ finden sich alle Ereignisse, die bislang im Rahmen der Anwendung eines Arzneimittels beobachtet und berichtet wurden. Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass diese Ereignisse mit diesem Arzneimittel in Zusammenhang stehen oder von diesem verursacht wurden.
Patienten sollten sich bei Fragen oder Bedenken aufgrund einer vermuteten Nebenwirkung daher immer an ihren Arzt oder ihren Apotheker wenden.
Schwerpunkt „Zu Risiken und Nebenwirkungen…“
- Erfahrungsbericht: So gehe ich mit Nebenwirkungen um
- Arzneimittel-Nebenwirkungen: Nachgefragt – 3 Fragen, 3 Antworten
- Missverständliche Beipackzettel: So behalten Sie den Durchblick
- Nebenwirkungen melden: Wie Arzneimittel noch sicherer werden
von Dr. André Said und Prof. Dr. Martin Schulz
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2019; 68 (8) Seite 30-32
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Aus der Community
Gut beraten – oder guter Rat teuer

9 Minuten
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
bloodychaos postete ein Update vor 4 Tagen, 19 Stunden
Hat noch jemand Probleme mit dem Dexcom G7? Nachdem ich letztes Jahr im Sommer über drei Monate massive Probleme mit dem G7 hatte bin ich zum G6 zurückgewechselt. Jetzt zum Jahreswechsel bzw. jetzt Ende Februar wollte ich dem G7 mal wieder eine Change geben. Ich war davon ausgegangen, dass die Produktionsprobleme inzwischen behoben sind. Aber spätestens am dritten Tag habe ich massive Abweichungen von 50 – 70 mg/dL. Setzstellenunabhängig. Meine aktuellen G7 wurden im Dezember 2025 produziert. Also sollten die bekannten Probleme längst behoben worden sein. Zuerst lief es die ersten Monate von 2025 mit dem G7 super, aber im Frühjahr 2025 fingen dann die Probleme an und seitdem läuft der G7 nicht mehr bei mir, obwohl alle sagen, dass die Probleme längst behoben seien und der Sensor so toll funktioniert. Ich habe echt Angst. Mir schlägt das sehr auf die Psyche. Zumal ich die TSlim nutze, die nur mit Dexcom kompatibel ist und selbst wenn ich zur Ypsopump wechsel ist da der Druck, dass es mit dem Libre3 funktionieren MUSS. Ich verstehe nicht, warum der G7 bei allen so super läuft, nur ich bin die Komische, bei der er nicht funktioniert.
-
thomas55 postete ein Update vor 1 Woche, 2 Tagen
Hallo,
ich habe zur Zeit die Medtronic Minimed 670G mit Libre als Sensor. Ich überlege, auf die 780G als AID mit dem Simplera umzusteigen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Sensor? Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? In der Vergangenheit wurden Neukunden der 780G nicht mit dem Simplera beliefert sondern nur Kunden, die die 780G schon länger nutzen. Das hat sich nach Aussagen von Medtronic-Mitarbeitern beim T1day heute genau umgekehrt. Mein Doc hat das vestätigt. Für mich als neuer Bezieher der 780G gut, für die Bestandskunden schlecht.
Danke vorab und bleibt gesund (von unserem Typ 1 lassen wir uns das Leben dank Technik nicht vermiesen!)
Thomas55 -
sayuri postete ein Update vor 1 Woche, 3 Tagen
Hi, ich bin zum ersten Mal hier, um mich für meinen Freund mit Diabetes Typ 1 mit anderen auszutauschen zu können. Er versteht nicht alles auf Deutsch, daher schreibe ich hier. Etwa vor einem Jahr wurde ihm der Diabetes diagnostiziert und macht noch viele neue Erfahrungen, hat aber auch Schwierigkeiten, z.B. die Menge von Insulin besser abzuschätzen. Er überlegt sich, mal die Patch-Pad am Arm auszuprobieren. Kann jemand uns etwas über eingene Erfahrungen damit erzählen? Ich wäre sehr dankbar!🤗🙏
Liebe Grüße
Sayuri





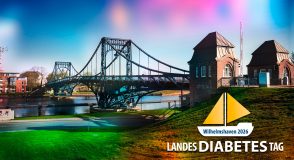


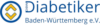


Kleine Ergänzung zum MeetUp von gestern.
Wenn ein “klassischer” Pumpenbetrieb ohne AID/Loop eine Option ist, dann tut sich eine breite Auswahl an CGM auf, die momentan auf dem deutschen Markt verfügbar sind:
Freestyle Libre 3 bzw. 3+
Dexcom G7
Dexcom G6 (noch)
Medtronic Guardian 4 (nur mit Medtronic-Pumpe)
Medtronic Simplera (nur mit Medtronic-Pumpe oder -Smartpen)
Eversense (implantiert für 1/2 Jahr, wird oft bei Pflasterallergien genutzt)
Accu-Chek Smartguide CGM
Medtrum Touchcare Nano CGM
Ich würde schätzen, dass die Reihenfolge ungefähr den Verbreitungsgrad widerspiegelt. Von Medtrum würde ich mir z.B. keinen grandiosen Kundenservice erhoffen. Aber wer weiß…?
Mag sein, dass ich etwas vergessen habe, aber die wichtigesten müssten dabei sein.