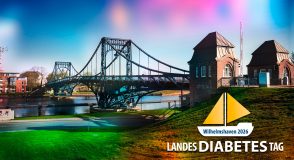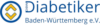- Soziales und Recht
Diabetes und Migration: Wie können Beratung und Versorgung besser werden?
5 Minuten

Wer in ein anderes Land kommt, muss sich an vieles Neue gewöhnen. Wer einen Diabetes mitbringt, für den sind die Herausforderungen noch einmal höher. Denn jedes Gesundheitssystem funktioniert anders, die Sprache ist erst einmal fremd, das Essen ist ungewohnt, die kulturellen Sitten und Gebräuche sind andere. Was es bedeutet, einen Migrationshintergrund und einen Diabetes zu haben, erfahren Sie hier.
Migrationshintergrund – was, wieso, warum?
Laut Statistik leben in Deutschland ca. 23,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Dies entspricht einem Anteil von ca. 28,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Jeder vierte in Deutschland lebende Mensch hat also einen Migrationshintergrund.
Wer zählt dazu und woher kommen die Menschen?
“Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.” Zusätzlich sind es Personen, die aus dem Ausland zugewandert sind, Eingebürgerte und Spätaussiedler sowie Kinder dieser drei Gruppen.
Laut offiziellen Quellen kamen im Jahr 2022 die meisten in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund ursprünglich aus der Türkei (ca. 12 Prozent), Polen (ca. 9 Prozent), Russland (ca. 6 Prozent) und jeweils bis zu 5 Prozent aus Rumänien, Kasachstan und Syrien. Aufgrund der jüngsten Kriegsereignisse steigt seit Februar 2022 die Zahl der Menschen aus der Ukraine stark an. So hat sich seit dem letzten Jahr die Anzahl der Ukrainerinnen und Ukrainer von 138 000 im Januar 2022 auf 1,16 Millionen im Dezember 2022 erhöht.
Diabetes und Migrationshintergrund
Heute kann man von mehr als 600 000 Menschen mit Typ-2-Diabetes und Migrationshintergrund in Deutschland ausgehen. Zahlreiche Studien bestätigen, dass im Unterschied zu der einheimischen Bevölkerung Menschen mit Migrationshintergrund früher und öfter an Typ-2-Diabetes erkranken und eine intensivere Therapie benötigen.
Dies heißt jedoch nicht, dass jeder Mensch mit Migrationshintergrund automatisch ein höheres Risiko hat, an Diabetes zu erkranken. Es sind sehr unterschiedliche Faktoren, die das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, erhöhen. Der sozioökonomische Status spielt dabei eine wesentliche Rolle bei allen Bürgerinnen und Bürgern. Das Risiko steigern z. B. ein niedriges Bildungsniveau, eingeschränkte Sprachkenntnisse, eingeschränkte Kenntnisse über medizinische Leistungen und damit eingeschränkten Zugang dazu sowie ein niedriges Einkommen.
Allerdings haben Menschen mit Migrationshintergrund doppelt so häufig keinen Schulabschluss und dreimal seltener eine Berufsausbildung wie Einheimische. Sie sind doppelt so oft von Armut betroffen und arbeitslos. Menschen mit Migrationshintergrund haben aufgrund dieser Risikofaktoren einen erhöhten Versorgungs- und Beratungsbedarf in Apotheken, aber auch in Kliniken und Arztpraxen.
Sprache als wichtiger Indikator für Beratungsbedarf
Verunsicherte Blicke, kurze oder keine Antworten in der direkten Kommunikation: Es gibt deutliche Zeichen, dass die notwendige Information nicht oder falsch verstanden wird. Fehlende Sprachkenntnisse sind in der Apotheke ein Indikator für vermehrten Beratungsbedarf.
Beispiel 1: Frau N., 68 Jahre alt, aus der Ukraine stammend, ist Stammkundin der Apotheke. Weil sie eine Insulintherapie durchführt, bekommt sie ein Blutzuckermessgerät auf Rezept. Sie spricht schlecht Deutsch und schämt sich, die Apothekerin zu fragen, wie sie das Gerät benutzen soll. Sie löst regelmäßig Rezepte für Blutzucker-Teststreifen ein. Ein Jahr später bringt ihre Tochter die Altmedikamente zur Entsorgung in die Apotheke. Hierbei sind mehrere ungeöffnete Packungen mit Teststreifen. Auf Rückfrage wird klar, dass ihre Mutter das Gerät und damit die Teststreifen nur sehr eingeschränkt genutzt hat.
Sprachbarriere überwinden
Wenn man Sprachbarrieren überwinden möchte, ist wichtig,
- die eigene Sprechweise anzupassen: kurze, klare und einfache Fragen stellen, Beratung anbieten,
- gedruckte Informations-Materialien in den häufigsten Sprachen in der Apotheke vorrätig zu halten, vor allem in Türkisch, Polnisch, Russisch, Rumänisch, Arabisch und Ukrainisch,
- die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen, die die jeweilige Sprache sprechen, bewusst einzusetzen, denn viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Apotheken haben inzwischen einen Migrationshintergrund.
Dr. Olga Grintsova – ukrainische Pharmazeutin
Dr. Olga Grintsova stammt aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine. Dort machte sie Abitur, studierte und promovierte an der Nationalen Universität für Pharmazie (NUPh) im Bereich Klinische Pharmazie. Anschließend ging Olga Grintsova nach Deutschland, um an der Ludwig-Maximilians-Universität München Public Health zu studieren und 2011 mit dem Master abzuschließen. Bis 2020 arbeitete sie in verschiedenen Apotheken in Deutschland und war im Pharmaceutical Network Europe (PCNE) aktiv. Aus familiären Gründen ging sie 2020 zurück in die Ukraine nach Kiew, von wo aus sie regelmäßig an ihrer Heimat-Universität Charkiw Gastvorlesungen hielt. Seit Februar 2022 lebt Olga Grintsova mit ihrer Familie wieder in Deutschland, arbeitet in einer Apotheke in Lemgo und an der Hochschule Bielefeld zum Thema Versorgungs-Strukturen für Menschen mit Diabetes.
Die wichtigsten Themen der Beratung in Apotheken
Die Dunkelziffer von nicht diagnostiziertem Typ-2-Diabetes ist nach wie vor hoch in der Gesamtbevölkerung, deutlich höher aber bei Menschen mit Migrationshintergrund. So ist eine Beratung und Aufklärung bezüglich Prävention und Frühdiagnostik des Typ-2-Diabetes für diese Menschen besonders nötig.
Beispiel 2: Herr Ö., 58 Jahre alt, ist Stammkunde in der Apotheke. Er ist übergewichtig und bekommt regelmäßig seine Blutdruck-Medikamente. Er war einige Monate in seinem Heimatland Türkei und erzählt in der Apotheke, dass er dort sehr viel abgenommen hat, trotz des guten Essens! Er trinkt während unseres Gesprächs durstig zwei volle Gläser Wasser. Die Apotheken-Mitarbeiterin misst, mit Herrn Ö.s Zustimmung, seinen Blutzucker. Mit einem Wert über 200 mg/dl (11,1 mmol/l) wird Herr Ö. zum Stellen der Diagnose an seinen Arzt verwiesen.
Eine Barriere zu effektiver Beratung und Aufklärung ist die Gesundheits-Kompetenz (Health Literacy). Dies ist die Fähigkeit, Gesundheits-Informationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und für Gesundheits-bezogene Entscheidungen anzuwenden. Zudem können kulturelle Überzeugungen im Gegensatz stehen zu empfohlenen Maßnahmen, wie Übergewicht als Schönheitsmerkmal bei Frauen oder Statussymbol bei Männern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das mangelnde Verständnis für das System des Gesundheitswesens in Deutschland. So nutzen Menschen mit Migrationshintergrund die Dienstleistungen von Fachärzten und Diabetologen seltener als die Bevölkerung ohne Migrationshintergrund.
Der Zugang zu moderner Diabetes-Technologie, wie kontinuierliches Glukose-Monitoring (CGM) oder Insulinpumpen, ist bewiesen abhängig vom Migrationsstatus. Daten aus dem Jahr 2019 zeigen, dass die Nutzung von CGM-Systemen bei Menschen ohne Migrationshintergrund 30 Prozent häufiger ist als bei solchen mit Migrationshintergrund. So besteht auch hier ein erhöhter Bedarf an Beratung und Erklärung.
Wünsche der Menschen mit Migrationshintergrund
Was wünschen sich Menschen mit Migrationshintergrund in Apotheke, Arztpraxis und Klinik? Sie wünschen sich, dass
- die Gesundheits-Kompetenz beachtet wird: Die Empfehlungen und die Beratung müssen verständlich sein.
- kulturelle und religiöse Unterschiede berücksichtigt werden: Bei Empfehlungen zur Ernährung hilft es, die Größe der Portionen genau zu beschreiben, da eine Portion je nach Kultur sehr verschieden sein kann. Beim Fasten muss auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, die Therapie anzupassen.
- Gesundheits-Kompetenz und Selbstmanagement zu fördern: In Apotheken können individuelle und strukturierte Beratungs- und Schulungs-Angebote für Menschen mit Diabetes und Migrationshintergrund angeboten werden. Initiativen gibt es schon, wie das Projekt GLICEMIA 2.0 der Bayerischen Apothekerkammer oder ein Schulungsprogramm vom Verband der Diabetes-Beratungs- und Schulungsberufe in Deutschland (VDBD) für Angehörige von Menschen mit Diabetes und Migrationshintergrund, bei denen das Selbstmanagement eingeschränkt ist.
Wer mehr wissen möchte, findet hier weitere Informationen:
- Statistisches Bundesamt: Migration und Integration
- DDG Arbeitsgemeinschaft Diabetes & Migranten: Informationsmaterialien in Fremdsprachen
- Şat S et al.: Diabetes und Migration. Praxisempfehlung der Deutschen Diabetes Gesellschaft. Diabetologie und Stoffwechsel 2022; 17 (Supplement 2): S411 – S431
- Wissenschaftliches Institut für Prävention im Gesundheitswesen: GLICEMIA 2.0 – eine randomisierte, kontrollierte Studie zur Sekundär- und Tertiärprävention bei Typ-2-Diabetes
Schwerpunkt: „Forschung – besser leben mit Diabetes“
- Medikamente: Deprescribing – wenn weniger mehr sein kann
- Lieferengpässe bei Medikamenten – ein Problem mit vielen Ursachen
- Diabetes und Migration: Wie können Beratung und Versorgung besser werden?
- Neues Aktionsbündnis zur Versorgung von Patientinnen und Patienten
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2023; 72 (10) Seite 24-27
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Aus der Community
Erfahrungsbericht: Mein Weg zur Insulin-Therapie bei Typ-2-Diabetes

7 Minuten
- Leben mit Diabetes
Diabetes-Anker-Podcast: „Weil du es kannst“ – im Gespräch mit Shirin Valentine über ihr neues Buch
Keine Kommentare
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
thomas55 postete ein Update vor 3 Tagen, 14 Stunden
Hallo,
ich habe zur Zeit die Medtronic Minimed 670G mit Libre als Sensor. Ich überlege, auf die 780G als AID mit dem Simplera umzusteigen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Sensor? Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus? In der Vergangenheit wurden Neukunden der 780G nicht mit dem Simplera beliefert sondern nur Kunden, die die 780G schon länger nutzen. Das hat sich nach Aussagen von Medtronic-Mitarbeitern beim T1day heute genau umgekehrt. Mein Doc hat das vestätigt. Für mich als neuer Bezieher der 780G gut, für die Bestandskunden schlecht.
Danke vorab und bleibt gesund (von unserem Typ 1 lassen wir uns das Leben dank Technik nicht vermiesen!)
Thomas55 -
sayuri postete ein Update vor 4 Tagen, 13 Stunden
Hi, ich bin zum ersten Mal hier, um mich für meinen Freund mit Diabetes Typ 1 mit anderen auszutauschen zu können. Er versteht nicht alles auf Deutsch, daher schreibe ich hier. Etwa vor einem Jahr wurde ihm der Diabetes diagnostiziert und macht noch viele neue Erfahrungen, hat aber auch Schwierigkeiten, z.B. die Menge von Insulin besser abzuschätzen. Er überlegt sich, mal die Patch-Pad am Arm auszuprobieren. Kann jemand uns etwas über eingene Erfahrungen damit erzählen? Ich wäre sehr dankbar!🤗🙏
Liebe Grüße
Sayuri -
cina_polada postete ein Update vor 1 Woche, 1 Tag
Hi, ich bin Julija und komme aus Frankfurt. Vor ein paar Wochen wurde bei mir Diabetes Typ 2 mit gerade mal 33 Jahren diagnostiziert.. Kämpfe im Moment noch sehr mit der Diagnose und würde mich über etwas Austausch sehr freuen 🙂
-
lena-schmidt antwortete vor 6 Tagen
Hallo Cina,
wir vom Diabetes-Anker treffen uns am 25.2 virtuell per Teams falls das für dich relevant ist 🙂
Schau gerne mal in den Veranstaltungen
Liebe Grüße
Lena
-