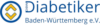- Behandlung
Jugendliche mit Diabetes: Auf dem Weg in die Selbstständigkeit
4 Minuten

Im Jugendalter ändert sich viel: Die geistigen Möglichkeiten werden größer, aber auch der Freiheitsdrang und gleichzeitig der Wunsch, in einer Gruppe von Gleichaltrigen nicht aufzufallen. Oft führt dies dazu, dass Jugendliche das Diabetesmanagement vernachlässigen und der Übergang in die Erwachsenenmedizin nicht gut gelingt. Die Eltern sollten also am Ball bleiben, aber auch eine Änderung der Versorgungsstrukturen könnte die Situation verbessern.
Mit dem Eintritt ins Jugendalter ist nicht nur ein eindrucksvoller Wandel der äußeren Erscheinung, sondern auch der geistigen Möglichkeiten verbunden. Jugendliche wie Peter (siehe „Der Fall“) können dann wie bei einem wissenschaftlichen Experiment vorgehen, Hypothesen bilden und deren systematische Überprüfung planen. Damit können sie grundsätzlich die Therapieprinzipien verstehen und sie im Alltag systematisch, z. B. bei der Insulindosisbestimmung, anwenden.
Wenn die Abnabelung beginnt…
Jugendliche zwischen 12 und etwa 15 Jahren sind nicht mehr Kinder, aber bei weitem noch nicht erwachsen. Sie fordern Unabhängigkeit und Freiheit, suchen aber gleichzeitig Unterstützung und Fürsorge. Mit provokantem, manchmal aggressivem Verhalten versuchen sie, sich von ihren Eltern und deren Werten zu lösen.
Zugleich fürchten sie aber den Verlust der Geborgenheit in der Familie. Die Eltern bleiben wichtige Gesprächspartner und Ratgeber bei der Diabetestherapie. Eine Vereinbarung fester Zeiten, zu denen man gemeinsam über das Thema „Diabetes“ spricht, kann helfen, wieder zu einem konstruktiven Austausch zu kommen.
Fallbeispiel: Peter (14 Jahre) hat seit 5 Jahren Diabetes
Peter verabreicht sich sein Insulin mit zwei Pens. Seit einem halben Jahr scheint ihm der Diabetes Probleme zu bereiten. Die neuen Freunde dürfen nicht davon erfahren, er scannt seine Glukosewerte selten, den Eltern zeigt er seine Messwerte nur widerwillig, sein HbA1c steigt an. Seine Eltern sind besorgt und fragen, ob Peters Verhalten noch normal sei. Sie suchen Rat, wie sie ihrem Sohn helfen können. Auch machen sie sich Sorgen, was passiert, wenn er nicht mehr vom Kinderdiabeteszentrum betreut werden kann.
Schulung bleibt wichtig
Die Jugendlichen verbringen zunehmend mehr Zeit außerhalb elterlicher Kontrolle, sie leben spontan und müssen folglich mehr Verantwortung für ihre Diabetestherapie tragen. Darauf sollten sie in Schulungen vorbereitet werden. Das tägliche Erleben des Abweichens der eigenen Stoffwechselwerte vom idealen Therapieziel von mehr als 70 % Zeit im Zielbereich belastet Jugendliche zusätzlich. Wenn die Glukosewerte in der Pubertät trotz Anstrengung unvorhersehbar schwanken, wird die eigene Kompetenz angezweifelt. Gefühle der Hilflosigkeit und Abhängigkeit beeinträchtigen das Selbstbild.
Manche Jugendliche können nur dadurch ein positives Bild der eigenen Person aufrechterhalten, indem sie unerwünschte Werte nicht dokumentieren bzw. ihre Glukosewerte überhaupt nicht mehr scannen oder ansehen oder die Therapie insgesamt vernachlässigen. Studien haben gezeigt, dass Jugendliche, bei denen Eltern trotz aller Kommunikationsprobleme beim Diabetesmanagement involviert bleiben, langfristig besser mit Diabetes klarkommen als solche, die frühzeitig alles allein bewältigen müssen.
Wechselnde Dimensionen des Diabetes
Obwohl bereits jüngere Kinder sagen können, dass „ihr Diabetes nicht mehr weggeht“, werden erst Jugendlichen die Tragweite der chronischen Krankheit und deren Folgen für ihr weiteres Leben bewusst. Folgeerkrankungen werden für Jugendliche zu einer realen Bedrohung der eigenen Lebensperspektive. Emotionale Krisen, wie sie bei vielen Eltern nach der Diabetesmanifestation auftreten, können sich zeitverzögert bei Jugendlichen einstellen und zu aggressiven oder depressiven Verstimmungen, Resignation oder Verleugnung führen.
Mit dem Übergang in das späte Jugend- bzw. frühe Erwachsenenalter (etwa zwischen 16 und 21 Jahren) kommt es zu einer Phase der Stabilisierung: Das Leben älterer Jugendlicher richtet sich auf eigene Ziele und konkrete Zukunftsvorstellungen aus. Festere Beziehungen zu Gleichaltrigen werden geknüpft. Der Druck, so zu sein wie der Rest der Gruppe, lässt nach. Individualität und Selbstverwirklichung werden erstrebenswert. Das Verhältnis zwischen Eltern und Jugendlichen wird wieder weniger durch Alltagskonflikte belastet.
Übergang in die Erwachsenenmedizin
In den nächsten Jahren steht für Peter die Transition an, also der Übergang in die Erwachsenenmedizin. Entsprechend den Empfehlungen des Disease-Management-Programms für Menschen mit Typ-1-Diabetes erfolgt in Deutschland die Diabetesbetreuung unter 16 Jahren grundsätzlich durch ein kinderdiabetologisches Team.
Die Phase zwischen 16 und 21 Jahren gilt als Übergangsphase, wobei bei einer Weiterbetreuung in der Kinderdiabetologie zwischen 18 und 21 Jahren vielerorts eine Genehmigung von der Kassenärztlichen Vereinigung benötigt wird. Pro Jahr steht für ungefähr 2 000 junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes der Übergang von der kinderärztlichen Betreuung in die Erwachsenenmedizin an.
Allerdings verlieren 40 % der Jugendlichen mit einem Typ-1-Diabetes bei diesem Übertritt in die Erwachsenenversorgung den Kontakt zur Spezialmedizin, mit einem deutlich ansteigenden Risiko für eine schlechtere Kontrolle des Glukosestoffwechsels. Jugendliche zeigten nach dem Übergang ein 2,5-fach erhöhtes Risiko für eine ungünstige Blutzuckereinstellung (HbA1c-Wert über 9 %) verglichen mit Jugendlichen, die noch in der kinderärztlichen Versorgung geblieben waren.
Helfen Transitionsprogramme?
Besonders in der Kinderdiabetologie nimmt der Einsatz moderner Technologien (Insulinpumpen und Systeme zum kontinuierlichen Glukosemonitoring) rasant zu. Diese Entwicklung wird dadurch beschleunigt, dass sich die Behandlung von Kindern mit Typ-1-Diabetes überwiegend in wenigen spezialisierten Zentren konzentriert.
In der Erwachsenendiabetologie sind nicht zuletzt durch die große Anzahl der zu betreuenden Patienten mit Typ-2-Diabetes weniger Ressourcen vorhanden, um sich mit den raschen Veränderungen durch den Einsatz digitaler Hilfsmittel und Instrumente in der Therapie des Typ-1-Diabetes zu beschäftigen.
Vorhandene Programme, die den Übergang unterstützen (Berliner Transitionsmodell, ModuS-T, between), werden bislang nicht flächendeckend genutzt. Weiterhin liegen wenige Untersuchungen über den tatsächlichen Erfolg der unterschiedlichen Transitionsprogramme vor. Beim Übergang von Kindern mit Typ-1-Diabetes in die Erwachsenenmedizin kommen daher neben den seit vielen Jahren bekannten Problemen jetzt auch Unterschiede in der Ressourcenbereitstellung bei der Schulung und Interpretation von neuen Diabetestechnologien hinzu.
Brauchen wir Typ-1-Diabetes-Zentren?
Eine mögliche Lösung wäre die Schaffung regionaler Behandlungszentren mit kinderärztlicher und internistischer Betreuung für Menschen mit intensivierter Diabetestherapie und Nutzung von Diabetestechnologie sowie dem Einsatz der Möglichkeiten der Telemedizin.
Internationale Vergleiche zeigen, dass in Zentren, in denen innerhalb derselben Behandlungseinrichtung kinderärztliche und internistische Diabetesteams altersentsprechend Patienten betreuen, der Übergang wesentlich glatter verläuft und Menschen mit Typ-1-Diabetes über die gesamte Lebensspanne von der geteilten Erfahrung in der Nutzung von Diabetestechnologien profitieren. Wenn Peter einmal so weit ist, dass der Wechsel in die Erwachsenenmedizin bevorsteht, kann er hoffentlich schon aus verschiedenen Möglichkeiten zur Weiterbetreuung wählen.
Schwerpunkt „Dimensionen des Typ-1-Diabetes“
- Diabetes im Vorschulalter
- Auf dem Weg in die Selbstständigkeit
- Den eigenen Diabetesweg finden
- Hochbetagt leben mit Typ-1-Diabetes
Erschienen in: Diabetes-Journal, 2021; 70 (1) Seite 22-24
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Ähnliche Beiträge
- Technik
Darauf ist zu achten: Sicher mit dem Insulinpen umgehen

3 Minuten
- Bewegung
Faschingszeit: Gute Vorsätze – mit kurzer Pause
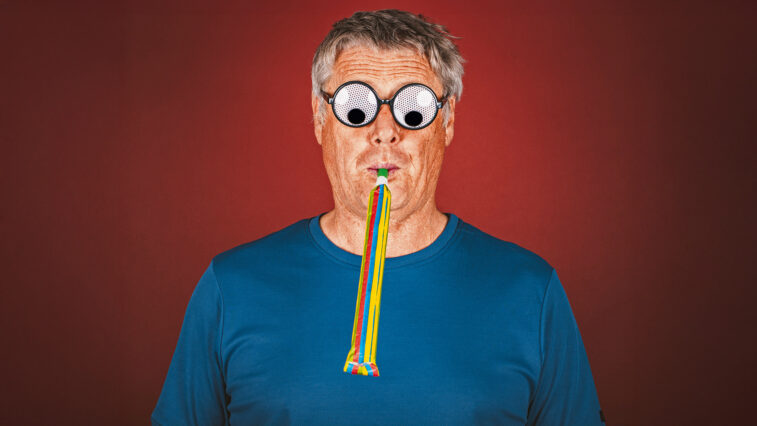
2 Minuten
Keine Kommentare
Diabetes-Anker-Newsletter
Alle wichtigen Infos und Events für Menschen mit Diabetes – kostenlos und direkt in deinem Postfach. Mit unserem Newsletter verpasst du nichts mehr.
Über uns
Geschichten, Gemeinschaft, Gesundheit: Der Diabetes-Anker ist das neue Angebot für alle Menschen mit Diabetes – live, gedruckt und digital. Der Diabetes-Anker und die Community sind immer da, wo du sie brauchst. Für alle Höhen und Tiefen.
Community-Frage
Mit wem redest du
über deinen Diabetes?
Die Antworten werden anonymisiert gesammelt und sind nicht mit dir oder deinem Profil verbunden. Achte darauf, dass deine Antwort auch keine Personenbezogenen Daten enthält.
Werde Teil unserer Community
Community-Feed
-
marina26 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Für alle Höhen und Tiefen vor 21 Stunden, 6 Minuten
Huhu, ich bin Marina und 23 Jahre alt, studiere in Marburg, habe schon etwas länger Typ 1 Diabetes und würde mich total über persönlichen Austausch mit anderen jungen Menschen/Studis… freuen, vielleicht auch mal ein Treffen organisieren oder so 🙂 Schreibt mir gerne, wenn ihr auch Lust habt!
-
wolfgang65 postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 1 Tag, 16 Stunden
Liebe Leute, ich habe zwei neue Erfahrungen mach dürfen, die Ursächliche nicht so schön, woraus die 2. Erfahrung (notwendig gut) resultiert!
Ich bin kein Liebhaber von Zahnärzten und meine dort geführte Gesundheitsakte ist mit einem riesigen “A” für Angspatient gezeichnet. Ende letzten Jahres ist mir beim letzten verbleibenden Weisheitszahn (nie Schmerzen gemacht) größeres Teil abgebrochen, ZA meint, da geht er nicht bei, weil Zahn quer liegt, allso OP, und danach könnte man sich über Zahnersatz unterhalten … ich natürlich in Schockstarre gefallen, – gleich am selben Tag bei OP-Zahnarzt Termin gemacht, vor Weihnachten nix mehr möglich, gleich Anfang Januar Termin bekommen, Röntgenbild lag dem Chirugen bereits vor. Vieles wurde besprochen, auch der Zahnersatz, wobei der Chirug gleich meinte, dass ausser WZ wohl 3 weitere Zähne raus müssten. Schock nr. 2! Ich wollte mir aber noch 2Meinung einholen und fand Dank guten Rat von Bekannten, einen anderen Zahnarzt, dem ich mein Leid und Angst ausführlich schildern konnte und der auch zum erstenmal die Diabetes in Spiel brachte … kurz um ein bisher bestes aufklärendes Gespräch, wie weit Diabetes auch auf die Zahne und Zahnfleisch gehen kann. Bei mir Fazit Paradontites. (die 1. unschöne Erfahrung). Der Weisheits- und daneben liegende Zahn sind inzwischen raus, – war super gute und schmerzfreie OP, danach keinerlei Schmerzen, durfte allerdings auch Antibiotika nehmen. Die 2. Erfahrung: ich konnte meine Insulindosies halbieren, – bei 10 Tg. Antbiotika, und nun 15 ohne Medizin noch anhaltend niedrige Insulinmenge, mit steigender festen Nahrungsaufnahme.
Heute bei Diabetologen bestätigt, das Diabetiker besonders auf Ihre Zähne und Zahlfleich achten sollten. Da frage ich mich warum der Zahnarzt da nicht im Vorsorgekatalog von DMP aufgenommen ist.
LG Wolfgang
-
laila postete ein Update in der Gruppe In der Gruppe:Diabetes Typ 3c vor 2 Tagen, 11 Stunden
Hallo ihr Lieben….Mein Name ist Laila…Ich bin neu hier…Ich wurde seit 2017 mit Diabetes 2 diagnostiziert.Da bekam ich den Diabetes durch laufen ohne Medies in den Griff.Das ging so bis Januar 2025.Ich weiss heute nochicht warum…aber ich hatte 2024 den Diabetes total ignoriert und fröhlich darauf losgegessen.Mitte 2025 ging ich Sport machen und gehen nach dem Essen.Und nahm immer megr ab.Htte einen Hb1C Wert von 8…Da ich abnahm, dachte ich, das der Wert besser ist…Bis Januar 2025…Da hatte ich einen HbA1C Wert von 14,8…Also Krankenhaus und Humalog 100 zu den Malzeiten spritzen…Und Toujeo 6 EI am Morgen…Irgendwann merkte ich, das mich kein Krankenhaus einstellen konnte.Die Insulineinheiten wurden immer weniger.Konnte kein Korrekturspritzen megr vornehmen.Zum Schluss gin ich nach 5 Mon. mit 2 Insulineinheiten in den Hypo…Lange Rede …kurzer Sinn.Ich ging dann auf Metformin…Also Siofor 500…Ich war bei vielen Diabethologen….Die haben mich als Typ 1 behandelt.Mit Metformin ging es mir besser.Meine letzte Diaethologin möchte, das ich wieder spritze.Ich komme mit ihr garnicht zurecht.Mein HbA1C liegt jetztbei 6,5…Mein Problem ist mein Gewicht.Ich wiege ungefähr 48 Kilo bei 160 m…Ich bräuchte dringend Austausch…Habe so viele Fragen…Bin auch psychisch total am Ende. Achso…Ja ich habe seit 1991 eine chronisch kalfizierende Pankreatitis…Und eine exokrine Pankreasinsuffizienz…Also daurch den Diabetes 3c.Wer möchte sich gerne mit mir austauschen?An Michael Bender:” Ich habe Deine Geschichte gelesen . Würde mich auch gerne mit Dir austauschen, da Du ja auch eine längere Zeit Metformin eingenommen hast.” Ich bin für jeden, mit dem ich mich hier austauschen kann, sehr dankbar. dankbar..Bitte meldet Euch…!!!
-
suzana antwortete vor 2 Tagen, 9 Stunden
Hallo Leila, ich bin Suzana und auch in dieser Gruppe. Meine Geschichte kannst du etwas weiter unten lesen.
Es ist sicher schwer aus der Ferne Ratschläge zugeben, dennoch: ich habe mich lange gegen Insulinspritzen gewehrt aber dann eingesehen, dass es besser ist. Wenn die Pankreas nicht mehr genug produziert ist es mit Medikamenten nicht zu machen. Als ich nach langer Zeit Metformin abgesetzt habe, habe ich erst gemerkt, welche Nebenwirkungen ich damit hatte.
Ja auch ich muss aufpassen nicht in den unterzucker zu kommen bei Sport und Bewegung aber damit habe ich mich inzwischen arrangiert. Traubensaft ist mein bester Freund.
Ganz wichtig ist aber ein DiabetologIn wo du dich gut aufgehoben fühlst und die Fragen zwischendurch beantwortet.
Weiterhin viel Kraft und gute Wegbegleiter! -
laila antwortete vor 2 Tagen, 7 Stunden
@suzana: Ich danke Dir für die Nachricht.Könnten wir uns weiterhin austauschen?Es wäre so wichtig für mich.Vielleicht auch privat? Gebe mir bitte Bescheid…Ich kenne mich hier leider nicht so gut aus…Wäre echt super…😊
-
wolfgang65 antwortete vor 1 Tag, 17 Stunden
Hallo Leila, auch von mir ein herzliches willkommen. Auch meine Geschichte liest du im weiteren Verlauf.
Zur “chronisch kalfizierende Pankreatitis” kann ich nix sagen, da ist immer das Gespräch mit dem Arzt/Diabetologen vorzuziehen, wie in allen Gesundheitsfragen. Was sagen Ärzte dazu, auch wg. der NICHTzunahme an Gewicht. Wenn ich mit einem Arzt nicht kann, oder dieser mir nicht ausreichende Infos gibt, schaue ich mich nach einem anderen Arzt/Diabetologen um, das ist Dein Recht, es geht um Deine Gesundheit!
Sollte mit der Nichtzunahme noch mehr dahinter Stecken, vielleicht
auch mal einen Psychologen in Deine Überlegung ziehen. Oder eine auf dich zugeschnittene Diabetes Schulung o.Ä., auch hier sollte Dich ein guter Diabetologe aufklären können.Soweit was mir im Moment einfällt. Lass es Dir gut gehen.
Gruss Wolfgang
-
michatype3 antwortete vor 1 Tag, 16 Stunden
Hey Laila, du kannst mir gerne hier im Typ 3c Bereich oder via PN schreiben. Ich bin gerade zwar etwas gesundheitlich angeschlagen, versuche aber, so gut es geht zu antworten.
-